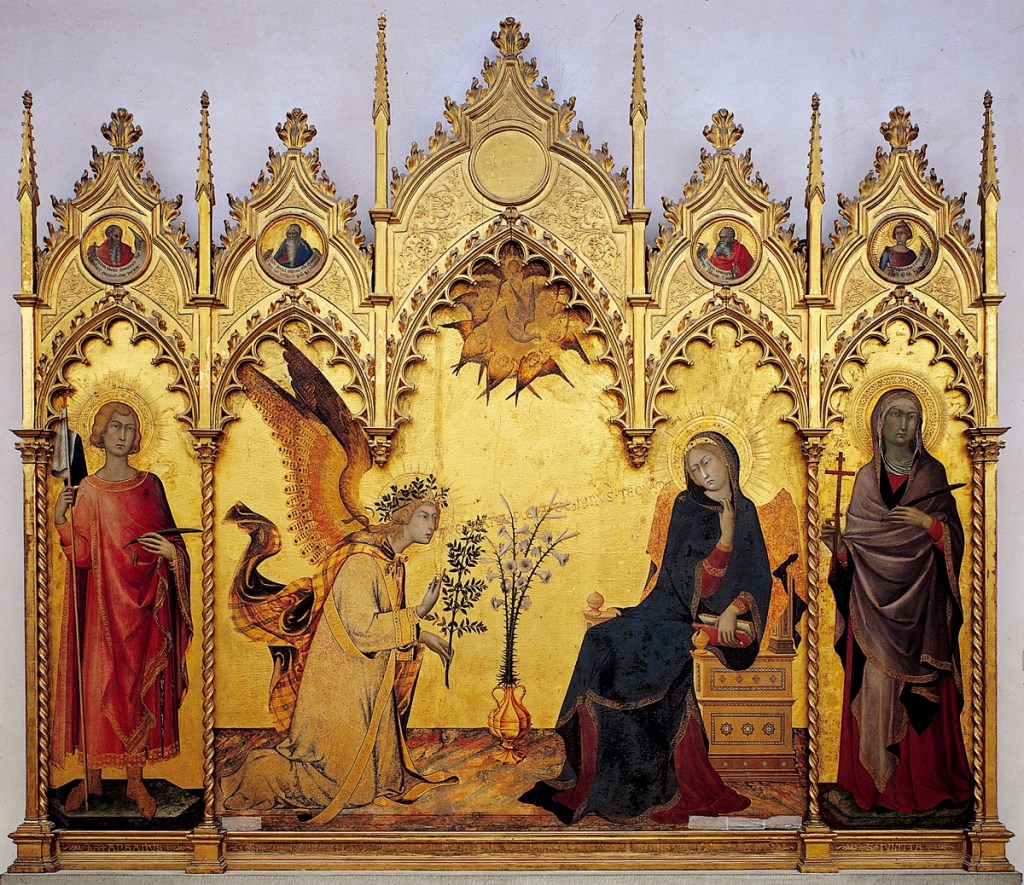Schmerz wellt die Zeit
Bricht Distanzen in Minenkörper
Weckt unselige Lüste
Ermutigt von den Sprenggradienten
(puh die Winkelzüge der Scherenschleifer)
Von den Tatsachenberichten bestickt
In denen nicht das Leid von wenigen aufkommt
Wandernde Walstätten verbaler Wehrlosigkeit
Rollt die Zeit mit Nervenenden wie Windentaue nicht in die Nähe
(wäre es nur Nähe)
Nicht in die Nähe und nicht in die
Von den unseligen Lüsten schiefen
Von minderen Wünschen beeinträchtigten
Behinderten Horizonte
Gespiegelt im Auge des Klippschliefers
Nein: in die peinlichen Punkte der Unaufmerksamkeit
Wo sich unverhofft die Nervenbahnen treffen
Von Mägden
Unerledigt wie Versprechen
Von Knechten
Bar jeder Wolligkeit
Aufkommend in den aufbrechenden Entfernungen
(oh andere Formen von Wissen)
Aus Meinung und Haltung
Mit steifem Glied und anschwellendem Ypsilon
Deren Körper tief in die zuckenden Massen von Zustand und Zudringen wollen
Willige Handreichungen für ungeschorene Grenzbeamte
Wach wachend hinter fischdurchzogenen Sprossenwänden
Hinter Harmoniumsklängen hustend
(puh das Seufzen der Fender Rhodes)
Wollene Kurbelkräfte im Morgengrauen
Unter die Nase gerieben von unseligen Monisten
Wache Wächter an welken leicht abfallenden Gerüsten
Trapper der felinen Fälle hinter Kurvenkräften
Vor den Toren Ninives
(oh andere Formen von Wissen)Aus Meinung und Haltung
Mit steifem Glied und anschwellendem Ypsilon
Deren Körper tief in die zuckenden Massen von Zustand und Zudringen wollen
Willige Handreichungen für ungeschorene Grenzbeamte
Wach wachend hinter fischdurchzogenen Sprossenwänden
Hinter Harmoniumsklängen hustend
(puh das Seufzen der Fender Rhodes)
Wollene Kurbelkräfte im Morgengrauen
Unter die Nase gerieben von unseligen Monisten
Wache Wächter an welken leicht abfallenden Gerüsten
Trapper der felinen Fälle hinter Kurvenkräften
Vor den Toren Ninives
Scham schwellt die Zeit
Spinnebeiniges Gieren
Spinnefeind den Tretmühlen
Den Halterungen zweiter Güte
Ursache für Hernien und Häresien
(puh die Meinungen der Asylbeamten)
Das leise Ticken der Unterwerfungen und Säumnisse
Das pressende Quellen der Hintergedanken in den Winkeln aus Verfügung und Verfugung
Glitzernder Stein an glitzerndem Stein und die Wände hinauf
Ein vorschnelles Vorhaben am vorschnellen Vorhaken
Eine Karawane von Kavernen und Caveat
(wie lebe ich nur wie lebe)
Und dazwischen die Nummerngirls in den Kurvengehöften
Assistentinnen der moribunden Moria
Aus Kabinen geschlüpft da hinten beim Fenster
Sehnenkräftige Vögel mit singendem Auge
An die Ferne gedrückt
(rote Algenblust bei Mwanza)
Geruchlose Pauker
Die sich über die Lachszüge beugen
(wo – bin – ich)
Die Rufe der Ibisse in den Gärten der Umkehr
Abgekehrte und abgeklärte Neigungen in einer Ordnung
Die von Tischen regiert wird
Von reglosen Rahmenbedingungen
Von Prozeduren des Protzes
In schleppendes Schlafen kurz vor der Vollinvasion durch
Nächste
In Nächten geboren ohne Geheul von Pennälern und Hyänen
In Wächten gewickelt voll lauterster Unternehmung
Und dazwischen die Brutkörbe in den Hebelkräften
(ich – in so einer schwierigen Zeit – wo – bin)
Und die Geierhorste der Rundfunkanstalten
Gefüllt mit Knochen und Macheten
Um Mandate ringend
Um ein Handgeld sich erklärend
Vom umsonst umkämpften Schemel heruntersteigend
Abstürze in Unschlüssigkeit vernachlässigend
Verbrennungen riskierend
Fein ziselierste Marmor-Prognosen ignorierend
Genfer Konventionen
Das Zimtwasser des Zögerns aufwühlend
Die berstenden Abendmahle und Pusteln des Widerstands beträufelnd und betäubend
Irgendwo an der demilitarisierten Grenze zur Willfährigkeit
(von Serrekunda von Sousse von Bobo-Dioulassa von Mopti von Durban von Dar es-Salam von Constantine von Lubumbashi von Gaborone von Bengazi von Nairobi von Lagos von Karabane von Kairo von Brazzaville von N’Djamena von Goma)
Pistille an den Bäumen erfüllt vom geheimnisvollen Geschmack der Erwartung
Borken schuppig vom Duft aus Ibiskot und vom Ruf des Wiedehopfs gefährdet
Ein Aufbrechen von Hernien und Horoskopen
(oh andere Formen des Wissens)
Steppengräser sich aufrichtend unterm Schritt der Besatzer
Im Stampfen der Tänzer sich regende Erdkrusten
In den Armkuhlen von Pedellen wachsende Plausibilitäten
Untersätze von Untersätzen von Untersitzern
Sehnenlange Spuren von Wunsch und Verdruss
Geknickte in lauterster Grammatik stehende Stuhlbeine an Tischen
An mitessenden Tischen
An nächsten Tischen
Auf denen die Professoren mit spitzen Hüten
Aufgeschnitten und ausgenommen werden
Tasten um Tasten
Ungewohnte Handreichungen für Abgesänge und Endzeiten
Sauerstoffarme Worte aus dem Rio Grande
Gierendes Gären über den Schrunden von Erdzeiten
In Kabinen kauernde Fussballmannschaften
Containerladungen mit zerfasernden Botschaften von Glück
Aufgepratzte präternatale Prämissen aus Diplomatie und Frühling
(mystérieuse réplique des pollens tout préparés pour les pistils)
Magenkunst und Menschenlust
Brutkörbe voller Bienenwaben
Schädel voller Löwenzähne
Heranschreitende Sicherheiten
Schwellkörper voller Wut und Scham
Im verschleppten Schlaf der Nervenenden
Ein nächstes Leben unter Bürzeln
Ausgelassene Adern der Befriedigung
Ungekämmte Haarsträhnen in Leang Timpuseng
(es verlangt dich gar nicht danach, mit deiner Frau und deinen Kindern ein rechtschaffenes, sicheres Leben zu führen, Bird.)
Steppengräser sich aufrichtend unterm Schritt der BesatzerIm Stampfen der Tänzer sich regende Erdkrusten
In den Armkuhlen von Pedellen wachsende Plausibilitäten
Untersätze von Untersätzen von Untersitzern
Sehnenlange Spuren von Wunsch und Verdruss
Geknickte in lauterster Grammatik stehende Stuhlbeine an Tischen
An mitessenden Tischen
An nächsten Tischen
Auf denen die Professoren mit spitzen Hüten
Aufgeschnitten und ausgenommen werden
Tasten um Tasten
Ungewohnte Handreichungen für Abgesänge und Endzeiten
Sauerstoffarme Worte aus dem Rio Grande
Gierendes Gären über den Schrunden von Erdzeiten
In Kabinen kauernde Fussballmannschaften
Containerladungen mit zerfasernden Botschaften von Glück
Aufgepratzte präternatale Prämissen aus Diplomatie und Frühling
(mystérieuse réplique des pollens tout préparés pour les pistils)
Magenkunst und Menschenlust
Brutkörbe voller Bienenwaben
Schädel voller Löwenzähne
Heranschreitende Sicherheiten
Schwellkörper voller Wut und Scham
Im verschleppten Schlaf der Nervenenden
Ein nächstes Leben unter Bürzeln
Ausgelassene Adern der Befriedigung
Ungekämmte Haarsträhnen in Leang Timpuseng
(es verlangt dich gar nicht danach, mit deiner Frau und deinen Kindern ein rechtschaffenes, sicheres Leben zu führen, Bird.)
(Das Bild verwende ich unter gemeinfreier Lizenz, siehe Wikipedia.)