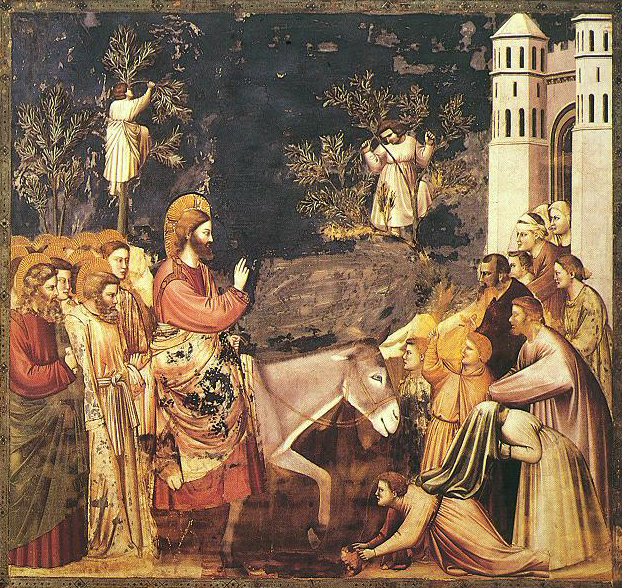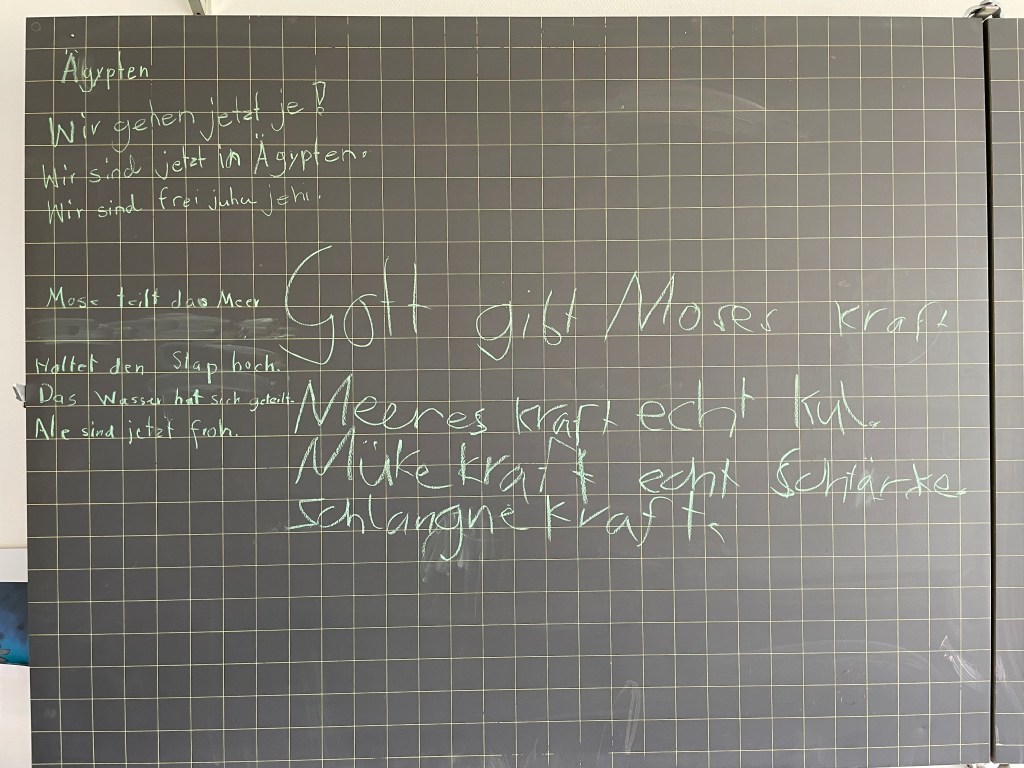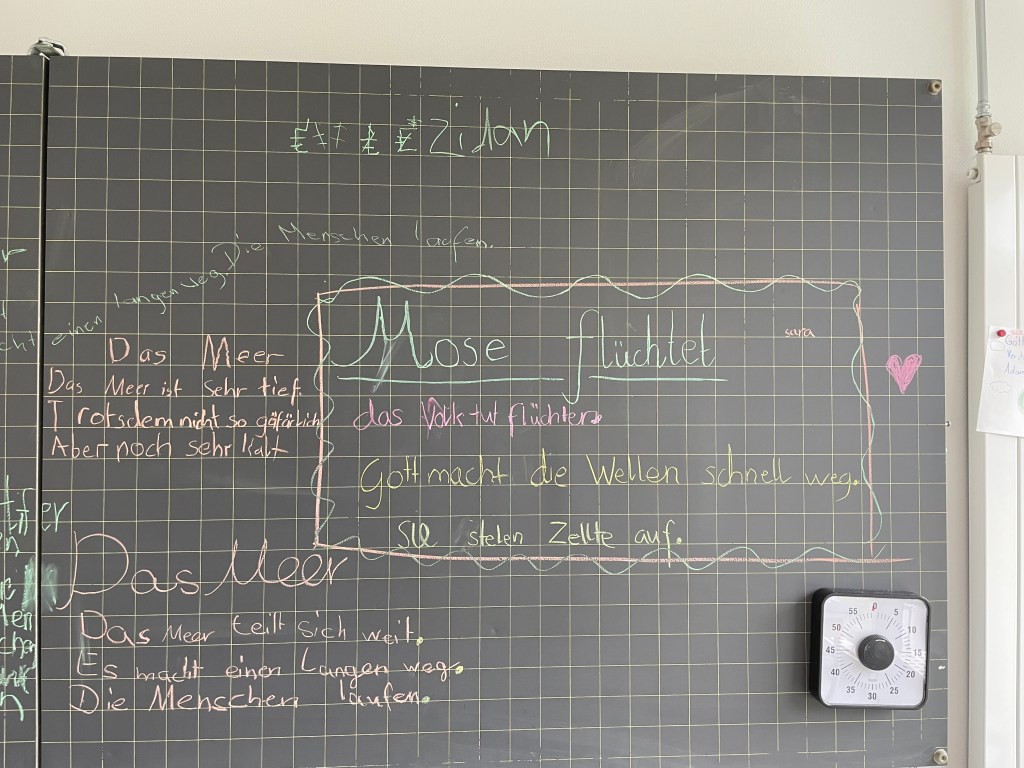Letzte Woche habe ich an einer Lesung das erste Mal das Gedicht «Rahels Gebet» vorgetragen. Das Gedicht schildert die letzten Momente der «Erzmutter» Rahel, die bei der Geburt ihres Sohnes Benjamin stirbt. Von der Moderatorin wurde ich darauf angesprochen, weshalb ich dieses Gedicht als mein «erstes in der Stimme einer Frau» bezeichne, wo es doch grade so strotze vor körperlichen Begriffen, die das Weibliche in einer patriarchalen Zuschreibung fixierten und daher beherrschten.
Diese Kritik hat mich beschäftigt, und ich habe mir dazu einige Gedanken gemacht, die ich hier nachzeichnen möchte.
Eine andere Männlichkeit?
Seit ich nicht nur weiss (kognitiv), sondern auch begriffen habe (affektiv), wie sehr ich als Mann (noch dazu als weisser Mann in einem europäischen Land!) privilegiert bin – und das ist zu meiner Schande noch gar nicht allzu lange her –, hat sich etwas in der Haltung zu meinen Gedichtstimmen verändert, das mehr als nur ein Perspektivenwechsel ist. (Einen Blick auf meinen damaligen Reflexions-Strang findest du unter «Unterdrückung der Frau und männliche Privilegien».)
Der Schock war umso kräftiger für mich, als ich mich als einen Mann verstehe oder interpretieren zu können glaubte, der keinerlei machoide Tendenzen oder Wesenszüge vorzuweisen hat. Meine Vorlieben waren im «strikten Sinne» gesellschaftlicher Typologisierung schon immer «un-männlich»: ich war weder sportlich noch interessierte ich mich für Autos oder wie auch immer geartete technische oder mechanische Vorgänge und Produkte. Meine Lieblingsfarbe ist pink, und wenn ich mutiger wäre, trüge ich jeden Tag High Heels, die ich liebe.
In anderer Hinsicht bin ich jedoch ganz Mann – abgesehen einmal von meinem «natürlichen» Interesse für das andere Geschlecht: ich rede viel lieber, als dass ich zuhöre; wenn ich Trost spenden soll, fühle ich mich hilflos und gebe einer unbegründeten, aber gut verwurzelten Wut Raum; ich habe auch keine Scheu, in einer Runde das Wort zu ergreifen, obwohl ich vielleicht weit weniger Kenntnisse über das zu besprechende Thema habe als die andern Teilnehmenden; desgleichen bin ich es gewohnt, dass mein Wort angehört wird und gilt, wenn ich es ergreife.
Je älter ich werde, umso weniger ausgeprägter werden die oben aufgezählten, von mir als spezifisch «männlich» und gesellschaftlich bedingten und bewirkten Züge. Auch hat mich eine Liebesbeziehung in den letzten Jahren vieles gelehrt, was mich verändert und «empfindungsfähiger» gemacht hat, was in mir die Fähigkeit des Sehens und Hörens auf die andere Person hat wachsen lassen.
Vielstimmige Gedichte auf dem Weg in eine neue Polyphonie jenseits des Dualismus
Meine Gedichte haben schon sehr früh mit vielerlei Ausdrucksebenen und Stimmen gesprochen, und es war nichts Aussergewöhnliches, dass in einem Liebesgedicht beide Stimmen der Liebenden mitgeklungen, mitgesungen haben.
In den letzten Wochen habe ich nun ein paar erste Gedichte «in der Stimme einer Frau» geschrieben. Dabei war mein Augen- und Sprachmerk vor allem auf der brutalisierten Erfahrung der Frau, auf ihrer Leidensgeschichte und -erfahrung, auch auf ihren biologischen und geschlechtlichen Merkmalen. In diesem «ersten Stadium», wie ich es bei mir nennen, bin ich noch ganz «Mann», noch ganz «Aussenstehender», «Unverständiger», «Missversteher»: das äusserliche und körperliche überwiegt in meiner Darstellung, die Biologie behält noch die Oberhand.
Biologische Begriffe als Hebel zur Veränderung?
Doch schon das Biologische ist ein wichtiger Anfang, wie mir im Rahmen der Beschäftigung mit meinem neuen Zyklus «Psalmen für Saul», in dem auch israelitische Frauenstimmen (von Sara über Rahel, von Rut über Ester bis Hanna und Maria) hineindringen, die patriarchale Welt dieses Gebirgsvolkes aufbrechen und durchdringen sollen. Denn nicht nur die Lebenswelten und -erfahrungen und die Stimmen der Frau wurden und werden in der Bibel und in vielen anderen religiösen Schriften unterdrückt, sondern mit diesen auch die ganze Körperwelt der Frau, und das «bildliche» Potenzial dieser – ja – anderen Körper.
Wenn es der Literatur und Kunst gelingen kann, diese Körperwelt und das damit verbundene Erleben und Wahrnehmen ohne patriarchalen Ventriloquismus in ihre Schaffen und Schöpfen zu übernehmen, wird sich auch die Wirklichkeit und die gesellschaftliche Wahrnehmung, Darstellung und Repräsentation nicht nur erweitern und bereichern, sondern verändern: zu einer mehrstimmigen, für Alteritäten offeneren und eindenkenden.
Biologische Begriffe und Merkmale als Metaphern
Doch was will das heissen, das Biologische, das biologisch Andere – auf das schon Simone de Beauvoir mit erschöpfter Geste gezeigt hat – einzudenken, in unser Denken und Handeln zu inkorporieren, inkarnieren?
Indem du die Sinnhaftigkeit biologischer Begriffe und Merkmale als Bereicherung und Welterweiterung in die Literatur und Kunst und somit vielleicht in die gesellschaftliche Realität hinausträgst. Das für mich beste Beispiel für eine solche Metapher, die in die Denkweisen und Handlungsweisen einer Gesellschaft einwirken kann, ist der biblische Begriff für das «Erbarmen» Gottes, «rahman», der auf die Wurzel «rächäm» – die Gebärmuter – zurückgeht.
Silvia Schroer und Thomas Staubli haben in ihrem Standardwerk «Die Körpersymbolik der Bibel» (1998) erstmals klar und eindeutig darauf hingewiesen, wie mächtig für das ursprüngliche, hebräische Gottesbild (und damit auch für das Menschenbild) diese «Mutterschössigkeit Gottes» (Schroer / Staubli) war – solange ein Begriff in seiner ursprünglichen Bedeutung präsent gehalten wird, werden kann, solange wird er auch das Menschen- und Weltbild mitprägen.
Dabei ist gleichzeitig nicht zu verleugnen, dass die Menstruation in der Bibel tabuisiert, der Frau in dieser Zeit mit dem Begriff der «Unreinheit» jegliche Würde abgesprochen wurde. Doch um mit Schroer und Staubli zu sprechen:
Vielleicht kann die biblische Tradition einer theologisch begründeten Würde des Mutterschosses aber in solchen ethischen Diskussionen eine herrschaftliche Funktion übernehmen und daran erinnern, dass der Schoss der Frau mehr ist als ein Objekt patriarchaler Interessen.
Schroer / Staubli (Hervorhebung von mir)
In eine ähnliche Richtung ist schon sehr lange vorher Ursula K. Le Guin vorgestossen, als die «Tragetaschentheorie des Erzählens» (The Carrier Bag of Fiction, 1989) veröffentlichte: hier wird ein äusseres Instrument (der Sack, der Beutel) im Mindesten zum Symbolträger für eine Veränderung des Erzählens, der Erzählhaltung: wie die von ihr geschriebene Science-Fiction sollte seither jede Literatur
ein Versuch (sein), das zu beschreiben, was passiert, was Leute tun und fühlen, wie Menschen sich zu allem andern im riesigen Sack Befindlichen in Beziehung setzen, zu diesem Mutterleib des Universums, zu dieser Gebärmutter der Dinge, die einst kommen, und dieser Grabstätte der Dinge, die einst waren, jener unendlichen Geschichte.
Ursula K. Le Guin
Rahel dem patriarchalen Diktat entziehen
Damit möchte ich den Bogen zurückschlagen zu den ersten Sätzen dieses Textes.
Was das erwähnte Gedicht betrifft, ging es mir in erster Linie darum, einer Frau eine Stimme zu geben, die so sehr unter patriarchaler Manipulation gelitten hat, Objekt patriarchalen Begehrens war und sich so sehr (laut der Bibel, die von Männern geschrieben ist) in das patriarchale Narrativ (eine Frau ohne Kind hat keine Würde) einpassen wollte. Das einzige, was wir von Rahel wissen: sie ist schöner als ihre Schwester (wer definiert denn bitte Schönheit?), sie bestürmt ihren Mann um Kinder, die ihr erst ganz zuletzt endlich geschenkt werden. Und wie eine andere Frau – die Frau des Samuel-Sohnes Pinheas – begreift sie im Moment der Geburt das Schicksal ihres Sohnes (und zukünftigen Stammvaters) Benjamin. Doch nicht einmal dieses Wort, in dem sie ihrem Kind einen Namen gibt (Ben-Oni, Schmerzenskind), wird ihr gelassen, denn ihr Mann Jakob «tauft» das Kind in «Glückskind» (Benjamin) um: entmächtigt sie in ihrem Willen und ihrer Würde als Frau ein letztes Mal, und das ausgerechnet im Todesmoment.
Dieser Entmächtigung und Entwürdigung will sich mein Gedicht widersetzen. Dass dabei körperliche Merkmale der Frau scheinbar typisiert werden, ist mir sehr wohl bewusst: die Verschiebung der Begrifflichkeit und Bedeutung von Zuschreibungen wird nicht auf einmal und vor allem nicht in einem einzigen Gedicht gelingen können.
Viele Fragen bleiben…
In der Anfrage der Moderatorin wurde mir also bewusst, wie wenig ich über das körperliche Empfinden und Fühlen der Frau weiss – und überhaupt über den anderen Menschen! -, obwohl ich ja selbst der Vater einer inzwischen fast erwachsenen Tochter bin.
Doch lass uns nochmals über den scheinbaren patriarchalen Ansatz dieses Gedichts reden: entmächtigt und entwürdigt es die Frau nicht ein weiteres Mal, wenn ich als Mann mir anmasse, in ihrer Stimme und «in ihrem Namen» zu sprechen? Darf ich als Mann denn nur mit der Stimme und im Namen des Mannes sprechen und denken?
Das Schreiben ist mein Lebenszweck, meine Lebensaufgabe – wenn ich nicht schreiben kann, sterbe ich, veröde ich, verliere jegliche Selbstachtung und Würde und Verfügungsgewalt über mich: ich bin jemand, der schreibt.
Wenn ich nun nur als Mann sprechen dürfte, würde das mich nicht auch ebenso entwürdigen? Würde es mich nicht in meiner menschlichen Würde in Frage stellen, wenn ich nur als Mann sprechen dürfte?
Kann ich als wenn auch ungehörter, ungelesener Schreiber-Schöpfer nicht über die Kraft meiner Texte und Worte eine «Anderwelt» schaffen; eine Welt, eine Geschichte, in der Weibliches und Männliches sich verbinden und bereichern – in der Stimme meiner Stimmen?
Das ist letztlich die Frage, auf die ich eine Antwort suche: Ob das blosse Verändern oder anders Verwenden von Zuschreibungen und Begriffsbedeutungen die Wahrnehmung deiner und meiner Welt verändern und damit die patriarchale Dualität und den kapitalistischen Sensationalismus und Konsumismus unterlaufen, unterströmen helfen können?
Und ich bin überzeugt, für diese Veränderung braucht es mich als Mann genauso wie meine Stimme als Frau.