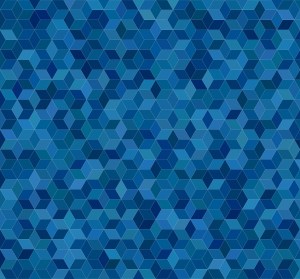Musik lässt sich als eine Form oder Entsprechung von Zeit lesen.
Ein deutlicher Anfang; wenn auch manchmal fast zögernd, flüsternd, sehr leise (Sibelius‘ Violinkonzert). Eine ausführliche, von Durchführung(en) und Fortführung(en) geprägte „Mitte“, die mit den Anfang zusammenhängt, aus ihm entspringt – und in das Ende zeigt, führt, das eine Bilanz, eine nochmalige Ver- und Aufarbeitung der musikalischen Ideen und Motive erfordert?, verlangt?, bedingt?
Ein Widerspruch zu diesem Verständnis von Musik oder diesen Erwartungen an Musik (oder Zeit) ist das musikalische Motiv des Ostinato: eine musikalische Figur wird immer wieder, wenn auch moduliert, minim verändert oder verschoben, wiederholt; ad libitum, da capo, ad infinitum.
Man sagt, Sibelius habe deswegen seine 8. Symphonie nicht fertigschreiben können, weil ihm sich genau diese Form immer wieder aufgedrängt habe. (Denke an Tapiola, das aus einem fast unendlichen Ostinato besteht, an Finlandia.)
Vor diesem Hintergrund scheint sich Sibelius eine andere Form von Musik (oder Zeit) angeboten zu haben: eine diskontinuierliche, eine stockende, eine nichtlineare. Diese Zeit (oder Musik) würde es ermöglichen, aus der Geraden, dem Endlichen, dem Gerichteten in einen Kreislauf auszubrechen, der keinen Zwecken und Erwartungen mehr zu gehorchen verpflichtet ist.
Je länger ich schreibe, umso klarer wird mir diese Notwendigkeit, „in einen Kreislauf auszubrechen“. Denn nicht nur ist das zeitliche Leben selbst unzähligen Repetitionen unterworfen (Schlafen, Essen, Zähneputzen, Duschen, Lachen, Weinen…), auch die Welt, die Natur verläuft in einem Kreislauf (Jahreszeiten als schönstes Beispiel). Mein Bemühen wird es also zunehmend sein, diesen Kreislauf mit Ostinato-Formen zu spiegeln und „einzufangen“.
Wie das die Musik schon kann, die Lyrik schon geübt, aber noch nicht genügend zugespitzt hat.
Autor: ofueglister
Antwort eines Toten
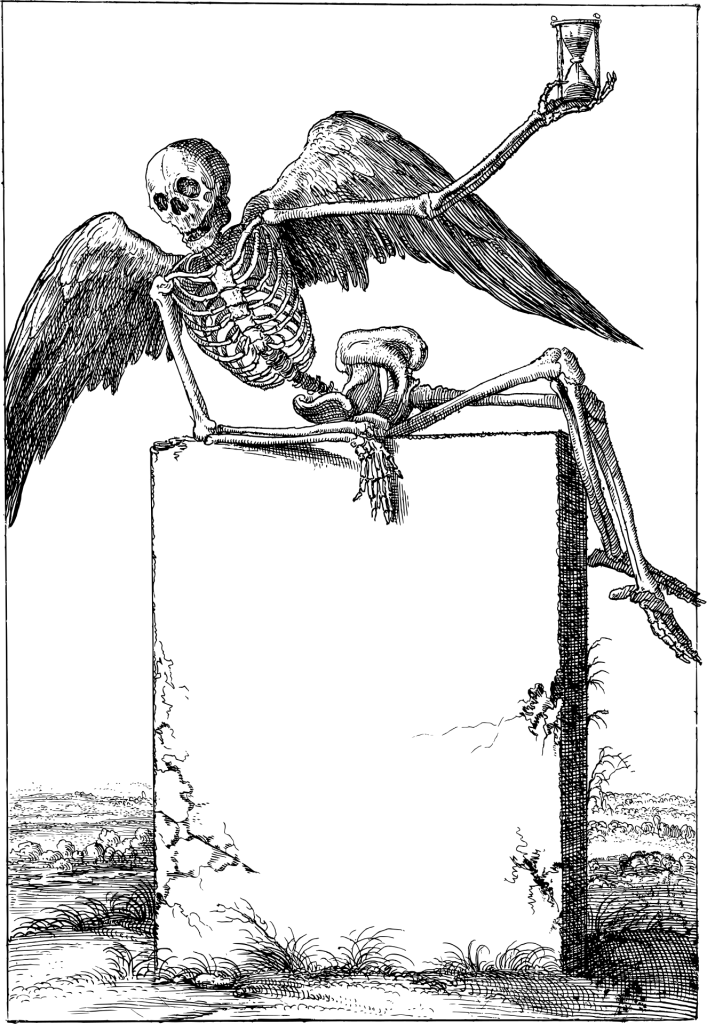
Du bist schon tot,
ich nenne dich mein Bruder nun,
du hast die Grenze schon übertreten,
du hast dich von dem Lebenden mitten im Leben abgewandt,
du blickst in die Richtung von Zweifel und Niedertracht,
rückwärts gehend blickst du vorwärts,
ganz wie Menschen tun, doch suchst du nicht nach der Frage,
die hinter der Grenze dich längst gefunden hat,
die hinter den Schatten deiner gewärtig ist,
du hast verlernt, wie es ist, in den Armen eines Menschen zu wohnen,
verschlossen ist dir längst die Freude des Wiedersehens,
du hast vergessen, wie es ist, eine Eselin zu hüten,
verlaufen hat sich das Tier schon lange in den Tälern vor Kirjat-Jearim,
der Herr hat über dich gesagt, was es über dich zu sagen gibt,
fortgedreht hast du deine Schritte vom Weg, der in die Abgeschiedenheit führt,
wo du gefunden werden konntest,
unsäglich sind die Dinge, die dir offenstanden dort hinter dem Ochsengespann,
ausgeträumt sind die Lebewesen, die unter deinem Antlitz gedeihen konnten,
bevor du noch hinter dem Ochsengespann versteckt auf etwas wartetest, das dir schon gegeben war,
das du schon erhalten hast,
und doch hast du nie davon gekostet,
hast davon nie noch probiert,
prüfend wogst du die Dinge und die Wesen in deinen schweren Händen,
als könnest du sie brauchen,
als könnest du sie wenden,
in deinen trägen Händen lagen Wesen und Ding,
schwer vor dem Entschluss und schwerfälliger nach dem Entschluss,
du hast nichts aufgehoben,
nichts hast du aufgenommen,
du warst keiner, der annimmt,
ein grauer Wanderer im grausamen Grenzland von Ohnmacht und Entmächtigung,
ich fühle mit dir, mein Bruder, glaube mir,
ich sehe dich fallen nach diesen Worten wie eine Zeder auf dem Libanon,
fallen aus der Hand des Lebens in die Klaue des Todes,
in die Asche und die Knöchelchen am Feuer sehe ich dich stürzen,
entkräftet und entmachtet,
dem süssen Staub des Dreschplatzes zugewandt,
und schon beginnt deine Zunge zart in dir zu schmelzen,
die Worte und Dinge sind ihr schon genommen,
verschlucke dich nicht an ihr, wie ich es tat,
wie ich meine vielgebrauchte Zunge zerbiss und zermalmte,
noch hat dich niemand gefunden,
diese für zu leicht befundenen ungeschlachten Körper eines verbrauchten Mannes,
der mehr als nur ein Haus hätte behüten können mit seinem mächtigen Schatten,
mehr als nur ein Fohlen hätte nach Hause führen können,
umschwärmt von den Müttern, umtanzt von den Töchtern Benjamins,
du bist schon tot,
eine Spanne trennt dich noch von mir,
und wieder hast du mich nicht danach gefragt, mein Bruder,
der ich warte darauf, seit ich dich hinter dem Ochsengespann hervorgeholt habe,
wolltest wieder nicht suchen,
im Suchen gefunden sein,
was hinter Ding und Wort denn ist,
was webt und strebt hinter den Werkzeugen.
Die weise Frau von En-Dor

Die Scham wächst in der Dunkelheit,
liegt wie Pech auf deinem inneren Gesicht,
als könntest du es vor dem glühenden Eifer der Sucherin verborgen halten,
und mag selbst der Bart deiner Fehler mit Asche bestreut sein,
aus Trauer oder Wut,
der Grimm und die Schuld mögen dich beugen wie das Gras im Morgen,
das wild blüht und unverwandt verwelkt,
wie die Fliege, die dich jetzt noch ärgert,
dein starres Gesicht mit dem Eifer umfliegt, der Aasfresser antreibt,
denn tot bist du schon, mein Sohn,
dem Tod entkommst du nicht mehr,
das Los spricht nicht mehr für dich,
der Traum gewinnt keine Kraft aus der Scham,
noch speist ihn die Furcht vor der eigenen Schande,
vor dem eigenen Ende kann der Traum dich nicht länger bewahren,
nur Hilfeschreie bleiben dir von Treue und Liebe,
als könntest du bewahren in Schwärze den letzten Schimmer von Ehre,
den letzten Abglanz des Geschöpfes, das sich aufbäumt gegen die Mauer aus Freiheit und Blösse,
die von der Heiligen um dich gezogen wurde,
weil sie dich hegen wollte,
weil sie dich lebend wollte,
und ich antworte dir, sage du mir, was du siehst, mein Sohn,
der wie das Mutterkorn in der Worfschaufel springt und hüpft,
der wie der Spinnenbiss am Leib des Volkes juckt,
dem selbst der Trauerschurz fehlt,
bloss und versklavt stehst du da, grosser Mann,
wie ist dein Gesicht da innen schon geschrumpft,
wie ist sein Blick schon abgewendet,
bestürzend ist es, wie deine Eingeweide in sich zusammengezurrt sind,
lehrreich ist die Enge deiner Kehle,
und dein verschattetes Gesicht, das innen liegt wie der Samen in der Frucht,
denn nur noch eines bleibt dir von all den andern,
die die Sucherin in dich gelegt hat,
doch angeschlagen ist deine Frucht, geschändet und geritzt ist ihre leuchtende Haut,
die dunkeln Finger der Heiligen haben sie schon berührt und gezeichnet,
das sage ich dir, das sehe ich,
und die Scham ist keine Scham vor deinen Schwestern und Brüdern mehr, mein Grosser,
auch die Heilige hat dich nicht verlassen,
die Scham ist Scham vor dir,
du Verschatteter und Verschattender,
nichts leuchtet mehr,
nichts leuchtet dir,
so schaue denn hin!
Vorzeitige Totenklage
Vorzeitig muss ich dich beweinen,
ein guter Mensch am falschen Ort,
der am Wort würgte wie Welpen,
vorzeitig ist deine Zeit erloschen wie das Morgenrot,
ein Unwürdiger, der einherschritt unter Steifhalsigen,
unter Nackenstarren wandtest du den Blick im Tanz und in der Blösse auf das niedere Wort,
da rissen die Feinde die Mäuler auf wie brüllende Löwen,
liessen dir nicht einmal den Trauerschurz,
da kauertest du im Rot mit den Abgerissenen, den Hysterischen, den Ledrig-Ärmsten,
fingest dich in ihren Worten,
fielest in ihre Gnade,
die von jenen, die ihre Fehler für gerechtfertigt halten, Ungnade geheissen wird,
von jenen, die ihr Gelingen an das hohe Wort hängen, aber nicht einmal über das niedere Wort hinauskommen,
vorzeitig willst du dich verabschieden,
umstellt von Bitterkeit und Qual,
zertreten wie die Trauben in der Kelter sind deine Taten vor der Zeit,
schon als du hinter den Ochsen hervorgezerrt wurdest, mein Bruder,
war dein Gesicht spitz wie das eines Vogels im Netz der Heiligen,
da begannst du dein Stottern und Kauen auf Kies,
dein Zähneknirschen über einer Aufgabe vor einem Volk,
das hinlänglich weiss und hinländlich tut,
als sei das Wort ein Hobel oder ein Hebel,
und mancher wollte es zupfen wie eine Zither,
und die greisen Häher des Landes waren vorzeitig in ihren Traumbärten versunken,
in denen das Opfermark sich mit dem Salböl und dem eingetrockneten Wein paarte,
da waren sie wie Geier über den Müllhalden draussen vor den Toren,
vorzeitig krächzten sie von deinen Vergehen,
von deinen verlaufenen Mühen stimmten sie Spottlieder an,
denn du bist anders als die Worte, die sie für das Wort gehalten haben,
ein guter Mensch zur falschen Zeit,
und die Unwendigen, die Zugedeckten, die ihre Mäuler aufreissen wie Trauerkleider,
wandten sich vorzeitig von dir ab,
ein Festmahl machten sie aus deinen gelenkigen Stümmelworten,
mit diesen unverborgenen und unverbogenen Worten,
es tobt und brennt in meinen Eingeweiden,
zu früh werf ich mich in den Staub.
Schaum-gewährt

Eingeboren in den Schaum
Rasen-Tafel im Frühlicht
Mustert es die Leitplanken:
Das Steuergetriebe im Vorwaschgang
Die Walbeute im Ansang
Hängt es im Andrang von Hebung und Zweck
Halb Koriander halb Salamander
Im Gelege: Schaum der letzten Magen
Brückt es auf zwischen frühen Zweigen und rüden Massen
Wishful thinking in gummierten Schleusen
Und endlich im Albanquartier die steppenbreite Situation von freien Malen und Neanderthalern
Beugt sich im scheuen Zwielicht in die Halskrone voller Kaviar und Bitterorangen:
Fakt bestrichen mit den Keimen von Folgerichtigkeit und Muttwitz
Maitanz aus Wut und Wachen
Gurgelt es im Aufguss
Gurrt es im Anhang
Selbsterfüllende Barkasse in der Waschstrasse des Feiertages:
Kümmernis in Safran getaucht
Mit Formularen überhaucht
Salzgestochen und ungebrochen
Glückt es im ersten Abstrich
Der Schleimhaut entstiegen
Strickleiter aus Walbein
Masst es sich etwas wie unvergleichliche Süsse an
Mitten im ölgetränkten Leberfleck
Im zerrütteten Organismus der Tage
Ein Bittbuch mit Haarfall und Stromnot:
Mustert es die käsigen Reihen
Umspült von den gaumenharten Kieselsteinen
Die ungesehen im Kreis gedreht und gewendet
Vom einkehrenden Wirbel aus Strich und Faden
Auf Bleiche und Grossem Wagen.
Ein Gedicht schreiben: Moderne Kunst?

Anlässlich der Vernissage meines jüngsten Gedichtbandes machte mir mein Freund, dem ich den Band gewidmet habe, ein starkes Kompliment. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich es im Augenblick richtig gehört und richtig verstanden habe, denn in jenem Moment war ich noch ganz im Rausch aus Angst, Nervosität und stolzer Begeisterung über das Vollbrachte, so will ich das, was ich hauptsächlich davon verstanden und mitgenommen habe, so formulieren: Nach langer Beschäftigung mit moderner Kunst habe er oft noch seine liebe Mühe damit; das Verstehen, Einordnen, Einschätzen falle ihm schwer wie den meisten; für ihn seien meine Gedichte gerade vor diesem Hintergrund interessant, weil sie ähnlich kompromisslos auf ihrem Daseinsrecht beständen wie viele moderne Kunstwerke, ähnlich kompromisslos unverständlich – in einer Form von Widerstand oder bewusster Verweigerung gewohnter Sichtweisen und überkommener Lesarten und -gewohnheiten; dass ich in dieser trotzigen, auf das Eigene, den eigenen Weg beharrenden Art lebe und schaffe, sei für ihn immer wieder ein Ansporn, sich der modernen Kunst und auch meinen Gedichten und Texten offen und bereit zu nähern. (Ich will es nochmals sagen: Es kann durchaus sein, dass ich das Kompliment meines Freundes ganz falsch verstanden und aufgenommen habe – und ich es hier also verzerrt und verfälscht präsentiere; wie das so oft mit an mich gerichteten Botschaften passiert.)
Dieses Kompliment kreuzt nun mit meinem poetologischen Nachdenken, das von einer nicht gesuchten Kritik angestossen wurde, die Klingen. Diese Kritik hat mir als Lyriker nahezulegen versucht, wenn ich auf mehr Anerkennung stossen möchte, bekannter und gelesener werden möchte, sollte ich meine Art zu schreiben ändern. Genauer: ich solle zugänglicher, verständlicher, dem Alltag und Empfinden der Lesenden näher schreiben; eine Sprache und eine Form finden, die gehört, verstanden, eingeordnet und geschätzt werden könne. Es ist dies ein Ratschlag, den ich schon zu oft gehört habe, um ihn noch wahrnehmen (vergessen denn annehmen) zu können.
***
In diesen Texten lerne ich verarbeiten und annehmen, wer ich als Lyriker bin. Nichts im Leben scheint mir dabei schlimmer als fehlende Selbstreflektion. Seit meinen ersten ernsthaften Anfängen vor 30 Jahren habe ich immer wieder versucht, meine Poetik zu verstehen und in kurzen Texten darzustellen und zu erfassen. Dabei haben mich drei Gefühle immer begleitet: Trotz, Wut und Scham.
***
Beschämung und Bescheidenheit
Fast jede meiner Lesungen vor nicht-lyrik-affinenem Publikum endet in einem Gefühl der Scham.
Scham darüber, dass meine Gedichte ein weiteres Mal auf anscheinend taube Ohren und von stereotypen Erwartungen verstockte Herzen gestossen sind.
Ich fühle mich über die immer gleichen Bemerkungen – «das ist doch kein Gedicht», «ich habe nichts verstanden» – und wohlgemeinten Anregungen – «vielleicht solltest du einfacher schreiben», «in deinen Gedichten sind einfach zu viele Bilder» – entwürdigt und erneut in eine Ecke gewiesen, aus der ich doch gerade, allen meinen Mut zusammennehmend, herausgetreten bin.
Nach der erste Erschütterung jedoch erkenne ich, dass ich kein Recht habe, meinen Gedichten solch einen Verrat anzutun. Wie andere, zugänglichere Gedichte haben sie eine Lebensberechtigung. Denn aufgrund ihres inneren Reichtums sehe ich meine Gedichte durchaus als Lebewesen an; jedes Mal, wenn ich frisch an eines herantrete, erweist es sich als verändert, weist eine neue Gestalt und Tragweite auf, zeigt seine mächtige Sprach- und Spannkraft.
So trete ich aus meiner Scham zurück in meine Bescheidenheit, in meine Demut. Ich wechsle vielleicht die Ecke, in der ich zuvor gekauert und gedichtet habe, aber nicht meinen Eifer und meine Versessenheit: Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben.
In dieser Bescheidenheit kann ich gut leben, genährt von der Scham: Nichts kommt zwischen mich und meine Sprachkunst, nur der strenge innere Richter kanzelt mich ab, wenn ich mich gehen lasse oder zu wenig konsequent bin.
Geduld und Wut
Zurück in meiner engen Kammer, die ich mit meinen Kugelschreibern weite, hat sich mein Gefühl verändert. Unbändig bäumt sich in mir die Kreativität, die Schaffenskraft und Schaffensfreude auf. Mit Beharrlichkeit horche ich auf diese Wut, die eine Wut aus Ohnmacht ist – die schönste Art von Wut.
Ein Zorn auch auf diesen Drang zum Schreiben. Er ist der Brunnen der Gedichte, der mich flutet. Murmelnd und schnaufend überquillt er noch stärker als zuvor.
Doch grundlegend ist die Wut über die Enge und Genormtheit dieser Welt, in die hineinzuschreiben ich mich bemühe – wohl wissend, dass ich sie niemals werde überschreiben können, vielleicht aber manchmal betäuben.
Als ich vor Jahrzehnten zu schreiben begann, war es mein erklärter Wunsch, mit einer ganz und gar eigenen Stimme die menschliche Erfahrung auszudrücken. Denn keine der Stimmen, die ich sonst vernahm in der literarischen Welt, sprach es so aus, wie ich es sagen würde. Das war mein allererster Antrieb.
Heute habe ich diese Stimme gefunden, geschaffen, ausgearbeitet – eine deutliche, eine unverwechselbare Stimme; sie ist die Frucht meines geduldigen, gehüteten Zorns, der immer wieder auf Anlässe stösst wie ein Irrender in einem Spiegelkabinett, – der immer wieder Gründe und Atemwege suchen muss, wie mit den Leiden und Lasten menschlichen Empfindens und Erlebens umzugehen, mit den eigenen Schwächen und Stärken hauszuhalten ist.
Trotz und Widerstand
Mit diesen beiden Bewegungen verbindet sich der tief in mir sitzende Trotz, Scheu und Abscheu in einem, gleichzeitig Verneinung und Entgegnung, aus dem heraus meine unverwechselbare Stimme stöhnt und schreit.
Wie ich mein Leben nicht nach den herkömmlichen Erwartungen und Vorstellungen leben, nicht dem Mammon Erfolg und dem Moloch Konsumismus opfern, keinen Besitz anhäufen und das Gute im Überfluss und in der weltschädigenden narzisstischen Machbarkeit suchen möchte, – so will ich auch mein Schreiben in Klarheit und Freiheit, in Kargheit und Armut, in Authentizität und Treue gegen diese Welt richten: ihr eine Sprache, ihr eine Kreativität entgegenhalten, die nicht nur ihre Abgründe, sondern auch ihre Möglichkeitsräume offenbart – und letztere sind keinesfalls mit den Machbarkeitsräumen von Wissenschaft und freiem Markt kompatibel…
***
Das Kompliment meines Freundes, mit de mich diesen Text begonnen habe, ist vor dem Hintergrund dieser Überlegungen und Deklarationen mehr als ein Ansporn: es wird zu einem Auftrag.
Wie die moderne Kunst für viele Menschen eine unverständliche, verschlossene und verunsichernd-herausfordernde Kommunikationsform ist, die aber laut und deutlich «anti» sprechen und meinen kann, so will ich nun auch meine Texte mit einem neuen Selbstbewusstsein schreiben: eine eigene, von mir selbst geschaffene und verfochtene Kunstform, die sich immer radikaler auf neue Sprachwelten einlässt, um sie wie ein Antidot als Bereicherung und Befremdung in die verstandene, genormte und machbare Welt einzuspeisen – dieser Welt aus meiner Kreativität jene Möglichkeitsräume einzuschreiben, die mir in ihr immer fehlen werden.
Schwellenauge

Das Auge schwillt weiss auf über dem roten Fleisch
Aus dem das gackernde Leben klang
Sprich tropische Dinge hiess es
Nichts hat mit etwas
Etwas zu tun: die Blüten der wütenden Zehrung
Das Wüten der blühenden Juckung
Unvertäute Stauung von Ehrgeiz und krossem Jochbein
Etwas hat mit nichts
Nichts zu tun
Die durchfeuchtete Daunenbude deines Mütchens
Das aufgezähnte Gurren der Tauben in der Eibe
Die drohende Klage der Katze
Der Stumpf deines Traums im bleichen Lüftchen:
Sprich von der Würze hiess es
Und etwas fiel mir ein
Mehr wie der Schaum auf dem Sud
Der mit dem Sieb abzuschöpfen ist
Nahrung für eine zitronenhäutige Zunge
Ohrung für die Muskatnuss eines Gebets
Das Lutschen am Finger hilft beim Denken an die ungeschriebenen Verse
Und das Auge im roten Fleisch
Eine erste Bitte um etwas wie unabhängiges Leben
Eine letzte Ehre für das Nichts
Aus dem du wächst:
An dem du wachst:
Dieses Nichts mit deinem Namen
Jochbeine und Knäuel von Rückenhaar und Mangel an Würze
Die Katze reisst die Tauben aus der Eibe
Hinaus in den taubengrauen Himmel
Der etwas ist wie Fleisch
Und die Tauben sind nichts wie die Daunenwände deiner rotrandigen Sumpfnächte
Sprich Nackendinge hiess es
Und mein Ellenbogen strich mit seinem gleissenden Auge über den blassen Schatten der Nase.
Ein Gedicht schreiben: Alles gleichzeitig

Von meinem Lateinunterricht in der Jugend ist mir eines in Erinnerung geblieben: die unglaubliche Mobilität der Wörter innerhalb eines Satzes (besonders der Adjektive und Adverbien). Dies vor allem bei den Dichtern: Suche das Adjektiv nicht wie im Deutschen bei seinem Nomen, sondern auch ein oder zwei Verse vorher oder nachher. In besonders schwierigen Texten schien mir das wie die buchstäbliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich hatte kein Verständnis für solche Extravaganzen, die mir von nichts eingefordert oder bedingt schienen – ausser vielleicht dem überkünstelten Zwang oder Bedürfnis, den Regeln eines Versmasses zu folgen.
Bedürfnis nach Entwurzelung
Heute jedoch verspüre ich genau dieses Bedürfnis der syntaktischen, oft auch der lexikalischen Entwurzelung. In jedem Gedicht kämpfe ich heimlich einen Abnützungskampf gegen den inneren Willen, die Bande und Regeln der Sprache abzuschütteln. Mit zunehmendem Alter und mit bald 40-jähriger Schreiberfahrung ist es mir mehr denn je bewusst, dass weder eine chronologische, lineare Gedicht- oder Erzählstruktur noch eine logische und kohärente Sprachgestalt das wiederzugeben, vergessen denn zu spiegeln, vermag, was wir Welt und Wirklichkeit nennen.
Dieses Gefühl ist ein wenig wie die Diskussion um Zufall oder Schicksal. Wie vehement und engagiert habe ich mich in der Jugend in unseren Streitgesprächen für das eine oder andere eingesetzt (obwohl ich eher ein Romantiker war, also das Schicksal, die Vorbestimmung favorisierte). Heute sehe ich klar, es geht nicht darum, diese beiden Wörter gleichermassen für eine logisch erklärbare, wenn auch in letzter Konsequenz der menschlichen Behändigung entzogene Deutung der Wirklichkeit stehen. Wer über Schicksal und Zufall diskutiert, ist in meinen Augen gänzlich auf dem Holzweg.
Schon damals als Jugendlicher begann ich zu verstehen, dass alles zersplittert ist, alles auseinanderfällt – in einem Interview für ein Lokalblatt sagte ich, ich nehme die Welt als von Augenaufschlägen zerschnitten wahr, es gebe nur diese unbeständigen Fragmente, – diese immer wieder auseinanderspickenden Steinchen eines Mosaiks, das wir zusammenzusetzen uns vergeblich bemühen und an dessen Einsicht und Deutbarkeit wir glauben, würde ich heute hinzufügen; doch das Mosaik ist genau in seiner losen, aufgelösten, immer sich selbst zerstörenden und sich stets wandelnden Form ganz und vollständig vollkommen.
Wenn ich an Erzählungen, Romanen oder Texten wie diesem hier schreibe, erfasst mich meist relativ schnell ein leichter Frust. Denn diesen Texten ist eine gewisse Form, eine vorgegebene Lexik, Semantik und Grammatik eigen. Sie zwingen mich zur logischen Folge, zur Chronologie, zur Linearität.
Fallende Verse
Ich weiss nicht mehr, wann in meinen Zwanzigern ich auf «Blanco/Weiss» von Octavio Paz gestossen bin. Es hat mich tief erschüttert. Dieses Gedicht, das in sich mehrere oder ein Gedicht enthält, ist in Farben markiert. Es verfügt über herausfaltbare Seiten. Dieses Gedicht hat mir die Möglichkeit aufgezeigt, die Räume und Irrealitäten, in die ich noch vorstossen könnte.
Ich hatte dieses Gefühl bereits einmal gehabt, bei Majakowskis fallenden Versen; auch hier wurden Regeln (des Lesens, der Lesegewohnheit) durchbrochen, das Gedicht war manchmal ein buchstäbliches revolutionäres Gemetzel, alles drunter und drüber, die Wörter und Bedeutungen fielen pêle-mêle übereinander (her). Diese Zeilenfälle hoben Wörter hervor, liessen sie vor- oder nachklingen, verliehen ihnen die Macht, den Sinn zu wenden.
All die Prozesse, all das Zucken
Egal, wie ich auf die Welt blicke, ob ich auf das Kleine und Innere, das Unmerkliche, oder auf das Grosse, Ganze, das Hyperobjekt schaue, – immer scheinen zwei Reaktionen möglich: die erstaunte Verzweiflung darüber, diese Vorgänge und Geschehnisse weder einordnen noch fassen zu können einerseits, und das verzweifelte Erstaunen darüber andererseits, wie tief und eingehend diese Geschehnisse und Vorgänge vernetzt und verkettet sind, sodass eine Schilderung und Abbildung in herkömmlicher Form nur eine Lüge sein kann.
Um dem, was geschieht und wahrgenommen wird, was für innere Abläufe auf die äusseren Vorkommnisse antworten (und umgekehrt!), gerecht werden zu können, scheint sich mir mit zunehmender Schreiberfahrung nur noch eine ähnliche Auflösung der Textstruktur, ihrer Kohärenz und Folgerichtigkeit als Lösung anzubieten.
Dabei bedingt der Eindruck von der Gleichzeitigkeit aller Prozesse die Gleichzeitigkeit der Wörter. So stelle ich mir das Gedicht manchmal als eine Art riesige, unendliche Liste oder Aufzählung vor; eine Liste jedoch, die nicht nach- oder untereinander reiht, sondern parallel, auf gleicher Höhe, gleichberechtigt und gleichzeitig aufführt und ausspricht.
Gleichzeitig empfinde ich dieses schöpferische Zucken, sobald ich auf etwas Inneres oder Äusseres stosse, als eine Aufforderung dazu, dieses Zucken und Reizen in einem Mal, ohne Zeitverlust und ohne Raumverlust zu rapportieren, protokollieren, in Sprache zu bannen. (Dass dies ein unmögliches Unterfangen ist, macht es nur desto notwendiger und dringlicher.)
Kreise schliessen
Und in diesem fortgeschrittenen Schreibalter, in dem ich mich befinde, sehe ich nicht nur um mich lauter konzentrische Zuckungen und Reize auf dem Spiegel meiner Wahrnehmung und in dem Brunnen meiner Gedichte, sondern erkenne, wie sich Kreise schliessen: zuerst jener, der die Vielfalt innerer Stimmen in das Gedicht hineinholt; jetzt also jener, in dem ich versuche, mindestens zwei Ereignisse (Träume und/oder Wirklichkeit) in einem Gedicht gleichzeitig auszusprechen, auszudrücken, zu beheimaten.
Anders gesagt: ich beginne das Gedicht immer mehr wie ein Gemälde zu bauen – etwa jenes von Giotto, das den Einzug Jesu in Jerusalem zeigt, wo ein Mann zwei- oder dreimal dargestellt wird, während er seinen Mantel erst auszieht, dann ausschüttelt, um ihn schliesslich vor den Füssen des Eselfohlens auszubreiten.
Ich beginne das Gedicht immer stärker wie eine Partitur zu begreifen, in dem die verschiedensten Klangfarben, Tonhöhen, Tonarten und Akkorde gleichzeitig und ungehindert aufeinandertreffen.
Und komme so, wie ich hoffe, der Abbildung, der Spiegelung menschlicher Zustände und der vielbelebten Welt einen weiteren Schritt näher.
Ein Gedicht schreiben: Das Ich ist eine Illusion

Ein Gedicht entsteht, indem du die Sprache wirken lässt. In meinen Augen ist das Gedicht ein Ort, an dem die Sprache herrscht. Viel stärker als in einer Geschichte oder in einem Roman, wo die Sprache in den Dienst genommen und eine Zweck, einem Ziel, einem Ende – der Logik und Kohärenz, der Wirklichkeit oder der Glaubwürdigkeit – verknechtet wird, – viel stärker als in jenen Texten soll die Sprache in einem Gedicht ledig und frei spielen können.
Das Gedicht ist ein Ort, wo Träume herrschen und/oder das Unsagbare. Es gedeiht dort, wo du zurücktrittst.
Wenn du die Sprache, die Laute, Assonanzen und Assoziationen herrschen und dich führen lässt, erkennst du in Kürze, dass dein eigener Wille, dein eigenes Wissen, dein intellektuelles Können von keinerlei Bedeutung sind.
Auf dem Weg zum Gedicht ist das Ich ein Hindernis. Ich erinnere mich sehr gut an jene Gedichte, mit denen ich unglaublich viel «vorhatte», von denen ich mir – angesichts ihrer Prämisse und der mit ihr verknüpften Ideen und den in sie verfrachteten Botschaften – sehr viel erwartete. Sie sind alle gescheitert, vertrockneten, versandeten, versiegten.
Einzig in jenen Gedichten, in denen ich mich selbst in allen Dingen hintangestellt habe, ist etwas passiert. Was genau da sich ereignet hat, ist im Nachhinein immer schwierig zu sagen.
Das Ich, von dem die meisten Lesenden annehmen, es sei das konkrete und handelnde Ich, das deinen Namen trägt – und das tun sogar jene, die um die literarische Figur des «lyrischen Ichs» wissen! –, dieses Ich ist nur die letzte Hülle von Ursache und Wirkung, Schicksal und Fügung, Zufall und Auflösung, die es abzuwerfen, abzustreifen, aus der es sich herauszuschälen heisst.
Denn hinter diesem bewussten, wissenden und wollenden Ich liegt der stille Mondspiegel, aus dem die Bilder und Figuren der Stimmen steigen.
Lässt du der Sprache ihren Willen, lässt du ihren Intellekt wirken, kannst du dich verlieren, vergessen: du bist ganz und gar unwichtig, unerheblich, du bist eine Illusion.
Immer wieder habe ich feststellen können, wie hinter der eigentlichen Absicht, mit der ich ins Gedicht gestartet bin, plötzlich andere Motive und Gesichte aus der Tiefe von Erfahrung und Erinnerung auftauchten.
Diesen Prozess des Hinter-sich-Lassens möchte ich auch gar nicht psychologisieren. Es würde ihn weder besser erklären noch besser beherrschbar machen. Denn das Beherrschen ist ja letztlich das allzumenschlichste, zerstörendste Streben.
In gewissen Momenten des Nachdenkens und Planens meiner Gedichte denke ich dann manchmal, wie schön es wäre, den (scheinbar) leblosen oder winzig kleinen Dingen und Wesen eine Stimme zu geben; in der Sprache des Menschen, gewiss, aber diese Sprache gänzlich in den Dienst einer anderen Lebensgrammatik, Erfahrungssyntax und Willenssemantik gebracht… Vielleicht würde es mir dann gelingen, ganz an die Grenzen, an den Rand der Sprache vorzustossen und ihren Herrschaftsbereich für eine kurze Weile zu verlassen, indem ich mich selbst aufgebe. Den Herrschaftsbereich just dann zu verlassen, wenn ich ihrer Herrschaft am stärksten gefügig geworden bin.
Ein Gedicht schreiben: „Metapherngestöber“

Im Nachdenken über eine Kritik meiner Lyrik, die entweder behauptet, meine Gedichte seien zu künstlich und/oder zu überladen mit Bildern, habe ich einige Antworten gefunden, warum das so ist.
Diese Antworten sind mir aus meiner Beschäftigung mit der Mystik erwachsen. Mystische Autor*innen überfluten häufig ihre Texte mit Bildern. Dabei setzen sie die Bilder in Gegensatz oder Widerspruch zueinander. In dieser Metaphernflut erfasst die Leserin ein Schwindelgefühl, ein Gefühl der Verunsicherung auch. In diesem Dammbruch aus Bildern entzieht die Mystiker*in der Lesenden jegliche Anhaltspunkte, auch jegliche Bezugnahme zur eigenen Wahrnehmung und zum eigenen Erleben. Der Bilderteppich zieht der Lesenden buchstäblich den Teppich der Wirklichkeit unter den Füssen weg. Plötzlich gilt nichts mehr, herkömmliche physikalische, sinnliche und sprachliche Gesetze sind für die Dauer dieser Texterfahrung ausser Kraft gesetzt.
Vor dem Hintergrund solcher Texte (etwa von Hildegard von Magdeburg) glaube ich folgendes über meine eigene Schreibweise sagen zu können:
- Die Reizüberflutung ist seit jeher eine prägende Erfahrung. Seit frühester Kindheit neige ich dazu, mich «in mein Kämmerchen» zurückzuziehen. Dort kann ich mich ganz auf etwas konzentrieren, was mir wirklcih wichtig ist: sei es das Lesen oder das Schreiben. So gerate ich nach einer gewissen Weile in einen schwebenden Zustand. In diesem schwebenden, von mir als gnadenvoll empfundenen Zustand erweitert sich meine innere Welt um ein Vielfaches. In diesem Hallraum, den ich oft als eine Art Spiegelkabinett wahrnehme, eröffnet sich mir ein Schallraum, in dem meine Gedichte erst möglich werden. Sie kommen aus dieser inneren Stille, dieser inneren Erwartungshaltung, die auf Geduldbereitschaft fusst.
- Die aufbrausenden Tiden-Laute des werdenden Gedichts bilden in ihrer zufälligen Intensität die «draussen vor der Tür» empfundene Reizüberflutung ab. In der wilden Anhäufung von Worten und Bildern, die in Assoziationen heranfluten und sich in Lauten verzückend verbinden, geschieht etwas süchtig Machendes, Magisches:
- Was ich bin und werde, findet einen erstaunlich genauen, wenn auch sehr reichhaltigen (übervollen) Ausdruck. Aus der inneren Stille schiesst hervor, was in mich hineingeschossen war. Doch in dieser Explosion, die ich selbst als Implosion empfinde, findet es eine Struktur, findet einen Lauf. Die gesammelte Innenwahrnehmung, die von der Aussenwahrnehmung gespiesen wurde, entpuppt sich als eine zutreffende Spiegelung sowohl des Innen als auch des Aussen.
- In letzter Konsequenz geschieht darin (im Text) ein Abgleich zwischen den äusseren Ressourcen und den inneren Kräften: das, was in der Stille in mir ist (das bin nicht ich), verbindet sich mit den Reizen aus meiner Persönlichkeit und dringt als Mitklang oder Widerklang in das Aussen, das mich beteiligt oder zur Beteiligung drängt / zwingt.
- In dieser so entstehenden Lautflut habe ich Gestaltungsmacht: habe sie jedoch nur solange, wie ich dem Zufall der Assonanzen und Assoziationen, der von den Lauten selbst angetrieben und befeuert wird, nicht Gewalt antue.
- Das Gedicht ist eine Moment-Geburt, ein Augenzwinkern lang. Es passiert schnell, in ein bis zwei Stunden muss es ganz raus. Jede Nachbesserung oder Veränderung wäre eine Schändung. (Natürlich kann es im Nachgang nochmals «abgeklopft» werden auf Unreinheiten; das sind meist Adjektive.)
- Die aufeinander zu und ineinander stürzenden Bilder jedoch sind ein prägendes Merkmal dieser Art, Gedichte zu verfassen. Es ist genau dieses «Getriebe» (Buber) und diese Sintflut, di e in den Augen von Lesenden auf der Suche nach Sinn und Aussage die Reizüberflutung, die Reisüberschüsse der äusseren Welt wiedergeben sollen.
Und damit möchte ich hier den Kreis schliessen zu den im Anfang erwähnten Mystiker*innen: auch in ihrem «Metapherngestöber», wie Dorothee Sölle diese gegensatzreiche Überfülle genannt hat, findet sich diese Form von Auflösung des Äusseren in einem inneren Wirbel, der reichhaltig (überreichlich) und erstaunlich genau den Lockungen und Wirrungen des Aussen antwortet. Und in dieser wilden, überbordenden Art des Sagens jedem Konformismus und jeder Erwartungshaltung an einen literarischen Text, vor allem aber jeder Verzweckung und jeder hiesigen Sinnhaftigkeit eine Absage erteilt.