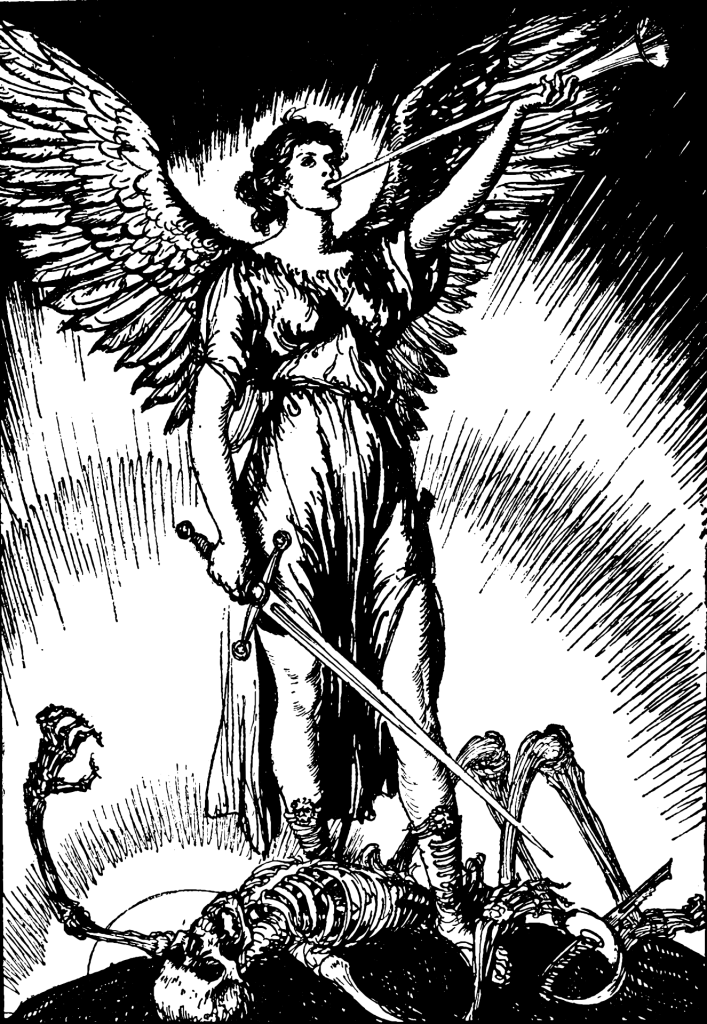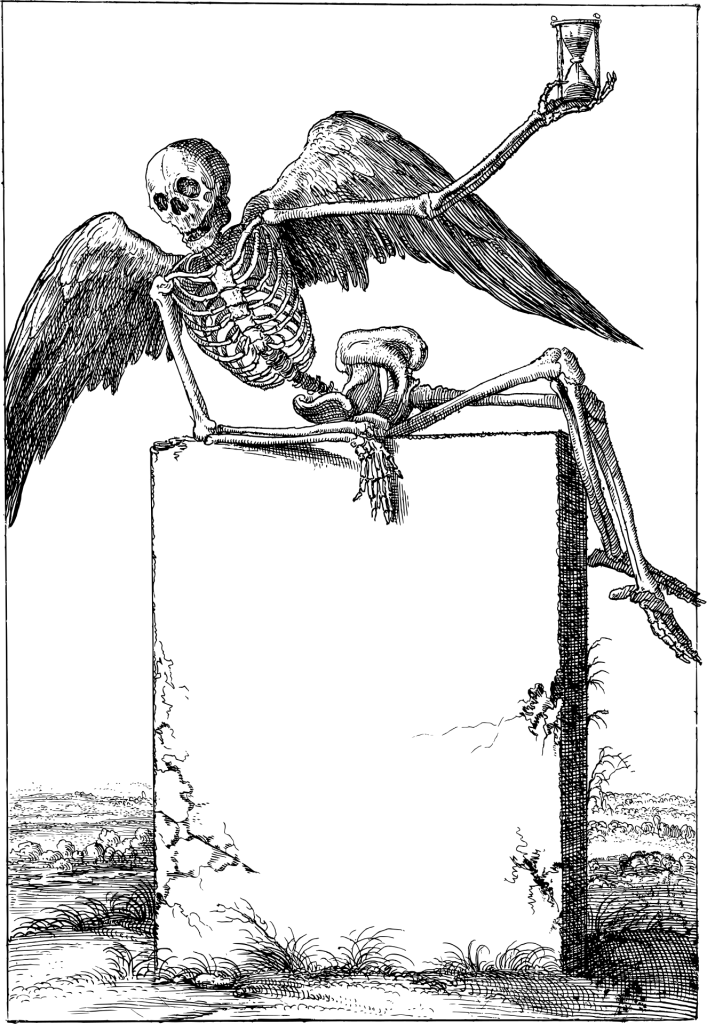Mein Sohn
Mein Söhnchen
Jetzt stehst du da
Wo kommst du her
Wie hab ich dich vermisst:
Dein Gesichtchen reingewaschen von der Liebe
Die ich erst über deinen vom Hunger vergewaltigten
Vom Mangel verunstalteten Körper
Ausbreitete und die ich dann
Über deine unreife Seele in ihrer Ungestalt legte
Zu schützen vor dem Vergessen
Diesem grossen Räuber
Gegen den die andern nur Wegelagerer sind:
Die Stimme in ihrem kindlichen Fiepen
Über den Fluss hinweg donnernd
Deine Stimme wie ein Dammbruch
Mein Sohn
Mein Söhnchen
Gross bist du geworden im Tode
Ein Flügelmann mit roten gütigen Augen
Ein Richter mit ausgeweinten Augen
Und schöpfst mit deinen Händen
Die noch nie einen Pinsel gehalten haben
Die ganze Welt mit aller Wirklichkeit darin
Die ganze Katastrophe mit allem vorsätzlichen Sein darin
Dahin und nimmst mit deinen Händen
Die noch nie eine Frau liebkost haben
Meine Schultern und stösst mich ein wenig unsanft
Durch die verschlossene Tür
Deren Holz sich bläht in der Feuchtigkeit des Morgens
Und auf der Schwelle rieche ich ein letztes Mal
Den Thymiangeruch deines abgeriebenen Neugeborenenkörpers
Und schmecke nochmals die Tränen meiner Frau in meinen Armen
Und weiss um das Sterben
Und um die Verlassenheit darin
Und auf der Schwelle spüre ich im Rücken die ganze Kälte deines aufgeschwollenen Leibs
Der immer noch den Hauch von den Händen deiner Mutter trägt
Die dich nicht lassen wollte
Nicht hergeben wollte
Mein Sohn
Mein Söhnchen
Woher kommst du nun
Wohin bringst du mich
Werde ich je wieder die Heimat sehen
Was willst du mir denn zeigen
So eile doch nicht so
Was müssen meine Augen
Was müssen meine Sinne noch fassen lernen
Von dir ein wenig unsanft geschoben durch diese verschlossene Tür
Um welche Daseinsformen
Um welche Dinghaftigkeiten
Muss ich meine schrumpfende Vernunft
Denn jetzt noch schlingen
Mein Sohn
Mein Söhnchen
Jetzt lass mich nicht allein
Ich bin doch nackt und klein.
—
(Bild von Sasin Tipchai auf Pixabay.)