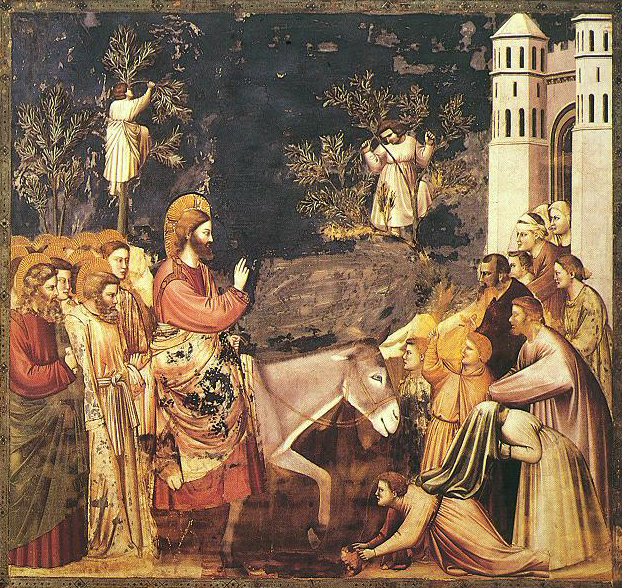(Dieser Text ist eine Reflexion auf ein Lyrikertreffen, das kürzlich zum Thema „Das Gedicht als Waffe“ abgehalten wurde.)
Ich beginne mit der Frage nach der Urheberschaft: Wer setzte dieses Thema?
Vetreten wurde das Thema von den drei leitenden Männern.
Meine eigene Reaktion auf das Thema war sofort eine begeisterte. Diese Begeisterung stammte einerseits aus meiner eigenen Poetik, die eine der Wut und der Auflehnung, des Widerspruchs ist. Wenn auch meine Gedichte inzwischen explizit in «Stimmen» geschrieben sind, so sprechen diese Stimmen doch immer aus einer Verletzung, aus einer Randständigkeit und aus einer Empörung heraus. Sie wollen treffen, «zurück verletzen», eine Reaktion und/oder im besten Falle eine verändernde Bewegung, eine andere Haltung bewirken. Insofern würde ich meine Poetik durchaus als ein waffenförmiges Sprechen beurteilen, ihre Gewaltbereitschaft bejahen. Es handelt sich dabei um eine Form der Gewalt aus und in Sprache, die ich von Rimbaud und Lautreamont gelernt habe: die Sprache zum Äussersten treiben, bis sie blossstellt oder blossgestellt ist.
Um es noch ehrlicher zu sagen: Ich hasse «brave» Poesie genauso wie ich unkonkrete Poesie hasse. Ich hasse die Poesie, die Harmonie predigt oder (ver)sucht. Ich muss mich immer sehr zusammenreissen in ihrer Gegenwart. Das heisst nicht, dass ich ihr ihre Existenz absprechen will, vergessen denn: kann. Ich finde nur, dass die Welt, in der wir leben, so nach Veränderung schreit, dass diese Veränderung nur in Radikalität, in der Sehnsucht nach Aufwurf, Ausbruch und Zerstörung gesucht werden kann. Und – das Wichtigste!: Ich weiss, dass diese meine Position ein ausgesprochen männliche, also patriarchale ist.
…
Im Exkurs, in der Einleitung, die unsere Debatte im Forum anregen wollte, erkannte ich und/oder glaubte ich zu erkennen, wie sehr sowohl dieses Thema als auch meine oben beschriebene poetische Haltung auf den in unserer westlichen geprägten Weltordnung auf den fast manichäisch zu nennenden Dualismus abstellen. Ich weiss ebenso, dieser Dualismus ist ein durch und durch patriarchaler.
Ich weiss auch, dass ich seit einigen Jahren schon auf dem Weg bin, diesem Dualismus entfliehen zu wollen, neue (Deutungs-?) Routen zu finden, um das weite Feld zwischen den beiden Polen (Frieden-Krieg, Frau-Mann, etc.) zu entdecken und eröffnen. Denn dieses weite Feld ist der eigentliche Handlungsraum, in dem wir Lebewesen uns befinden und einzig lebenswert bewohnen können.
Oh, es geht nicht um die Erweiterung dieses Raums!: Er ist gross genug für «alle/s dazwischen»!
Was es in meinen Augen mehr denn je braucht ist das Einnehmen von Positionen, die den ambivalent-grauen Bereich zwischen den beiden Polen eröffnen.
Dafür ist es vonnöten, dass die Männer in einer gemischten Runde zurücktreten, zurückhören, wahrnehmen lernen und können. Ich selbst weiss mit grosser Gewissheit von der Leichtigkeit, der Selbstverständlichkeit, mit der ich in einer Runde das Wort ergreife – häufig, ohne die andere Person, die andere Rede(nde) ausreden zu lassen, bevor diese Person in der Rede überhaupt erst so weit kommen konnte, um ihre eigene Position entweder darlegen oder aber finden und/oder erkennen zu können. (Denn wenn du «aus dem Schweigen» kommst, weil dir gesellschaftlich eine «schweigende Rolle» zugewiesen bekommen hast, dann kannst du nicht sofort sprechen, verbalisieren, was deine Position ist; du glaubst unter Umständen gar nicht, dass die Worte dir gehören, du hast ihren Gebrauch vielleicht nicht einmal erlernen können.)
«Ich habe begonnen, lerne es noch, mich zurücknehmen» heisst auch: Meine Ansicht, meine «Erkenntnis» weder für «logisch», «selbstverständlich», «selbsterklärend» oder «von gesundem Menschenverstand» (der bisher noch immer ein durch und durch männlicher ist) noch als «abschliessend» (im Sinne von «letztgültig») zu halten. Heisst auch, bereit zu sein, von dieser Position leicht und bereitwillig Abstand zu nehmen.
…
Mit einer Waffe zielst du auf etwas, auf eine Sache oder ein Lebewesen.
In Anwendung von LeGuins «Tragetaschentheorie der Erzählerin» möchte ich allen zurufen: sammelt statt zu zielen, vergesst die Gerade, die Linie, die Grenze, den Zweck!
In Anwendung des vorgängig Erläuterten möchte ich sagen: Verwendet das Gedicht nicht nur als eine Waffe zur Öffnung von Möglichkeitsräumen, sondern gebraucht das Gedicht absichtlich dazu, um in diesem Möglichkeitsraum, in diesen Möglichkeitsräumen Positionen einzunehmen, zu verdeutlichen, euch darin heimisch einzurichten – damit diese im Ambivalent-Grauen verborgenen oder vom Patriarchat bewusst vergessenen oder verschütteten Positionen auch lebenswert werden.
…
Ich wünschte mir den subsidiären Mann: Eine Person, die vom andern, von der anderen zu hören wünscht, der anderen, dem anderen eine Sprache zutraut; eine Person, die Abstand nimmt von ihrem biologischen Geschlecht und in den ambivalent-grauen Bereich eintritt; eine Person, die freiwillig den Raum des Sprechenmüssens (der ein Raum des Sprechendürfens ist) verlässt und Platz macht für die andere, den anderen.
Denn ich bin zutiefst überzeugt davon, dass dann geschehen könnte, was ich mir so sehnlich wünsche: die Ermächtigung des anderen Sprechens, des Sprechens der Frauen, der Transmenschen, der People of Color, der Lesben und Schwulen, der Queeren und natürlich all derer, die «unserem» Abziehbild des «normalen Menschen» nicht entsprechen können, weil ihre Beeinträchtigung, ihr Anderssein – das «unsere» «Normalität», die es nicht gibt, an der «wir» aber trotzdem festhalten, – in Frage zu stellen scheint – in Tat und Wahrheit ein Reichtum ist.
Dass ich diesen Wunsch so bestimmt und brüsk vortragen und vertreten kann, fast ohne mit einer Wimper zu zucken, entlarvt mich wiederum als einen aktiven Vertreter des Patriarchats, der sich des Sprechens für die anderen anmasst.
Ich will meine Worte jenen Stimmen schenken, die in mir wohnen und leben, die nicht männlich sind, die nicht schweizerisch oder mittel- und westeuropäisch sind, die nicht weiss sind, die nicht den Normen von «körperlich und geistig gesund» entsprechen.
Denn mein Problem ist: Ich kann nicht schweigen, ich muss sagen, ich muss dichten, schreiben, das ist stärker als ich. Das ist ein Auftrag, eine Verantwortung, die ich nach langem Kampf mit den herrschenden Normen und Werten dieser westlichen Gesellschafts- und Wirtschaftsform angenommen habe und zu verwirklichen versuche.
Jederzeit bereit, die Personen zu hören, zu achten und schätzen, die aus diesem Ambivalent-Grauen heraus sprechen, aus diesem Zwischenraum, der recht eigentlich Lebensraum ist, heraus zur Sprache, zum Wort finden, weil sie in ihm so lange schon Halt gesucht haben, den ich in der Nähe des einen Pols schon längst gefunden zu haben scheine.