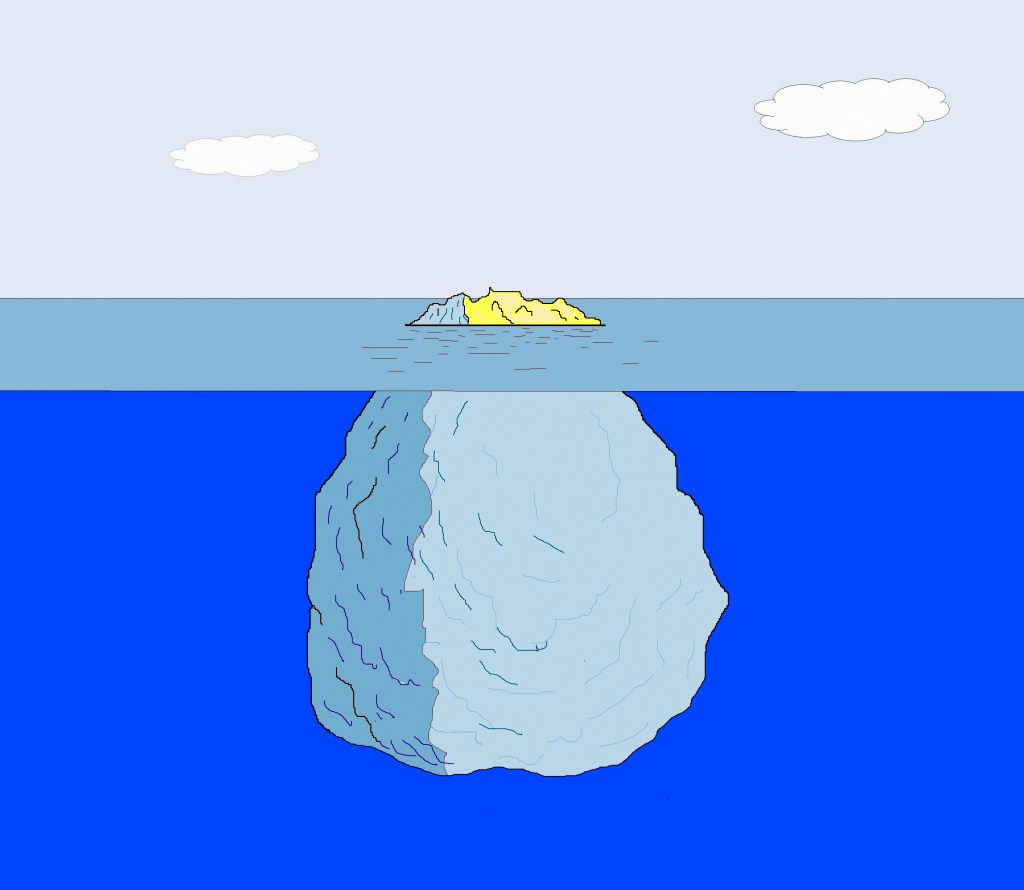Es gab keine Auswege. Das war das Gute. Es gab dieses Drehen im Kreis. Von der Stube, die zur Strassenseite lag, nach hinten in das Schlafzimmer, die zum Wald lag. Das Drehen war eine Schlaufe, die mit der Zeit Ecken bekommen hatte. Es war angenehm, den Richtungswechsel als 90 Grad-Winkel zu vollziehen. Die Kontrolle in dieser Bewegung fühlte sich an, als beherrschte er noch etwas. Zur Strassenseite waren die Rollläden heruntergelassen, dort war das Gehen wie Waten durch salziges Dämmerlicht. Der Kopf war oben im Dunkeln, die nackten Füsse unten im brackigen Schimmer. Zur Waldseite war es heller, mit der Zeit war der Raum von einem verschmierten Grün eingenommen worden. Die Strasse war leer und still, der Wald war näher gerückt. Aus dem Wald kamen Geräusche, die nicht genauer zu bestimmen waren. Die Geräusche hatten ihn lange an etwas erinnert, aber sie hatten sich nicht verändert. Er hatte aufgehört, sich für sie zu interessieren. Inzwischen war es wahrscheinlicher, dass die Geräusche in den Blättern entstanden. Die Blätter des Waldes waren zudringlich geworden. Wenn er vorne in der Stube war, drängten sie herbei und klopften an die geschlossenen Fenster. Wenn er im Schlafzimmer war, konnte er ihren Abstand zum Fenster überprüfen. Er schätzte den Abstand auf etwa 60 Zentimeter. Das war weniger als am Anfang. Aber die Fenster hatten Schmieren oder Schmisse von den Ästen. Die Pause in der Mitte seines Rundgangs war fast ein Ausweg, aber notwendig. Sie gestatte ihm, sich für kurze Zeit an den Stahlrahmen der Küchentür zu lehnen. Sein Kopf im Nacken, seine Schultern und seine Pobacken an den Rahmen gepresst. Der Rahmen war ein wenig kühler als die Luft in der Wohnung. Am Anfang hatte er mit dem Gesicht am Rahmen gestanden, die Stirn klopfend an den Rahmen gepresst. Doch das war ein Ausweg gewesen, das hatte er schnell begriffen. Das war gegen das Vergessen. Aus der Küche kamen die Gerüche. Sie beruhigten durch ihre zunehmende Stärke, bewiesen das Vergehen der Zeit. Sie waren lebendig. Neben der Küche lag die Toilette. Dort lief in dünnem Strahl das Wasser. Es kam lauwarm aus der Leitung. Hin und wieder war es nur ein Tröpfeln, laut wie das Pochen an einer Türe. Das Trinken daraus war notwendig in dieser Hitze. Wenn er dachte, war er erstaunt, dass das Wasser immer noch herauskam. Wenn er dachte, war manches erstaunlich. Nur schon das Denken war erstaunlich. Doch sein Gang setzte sich bald fort. Als er begonnen hatte, war das Urinieren ein Ausweg gewesen. Mit der Zeit aber hatte er sich daran gewöhnt, fast im Vorübergehen in die offene Schüssel zu spritzen. Er trug nur noch Socken. Er blieb nur noch an drei Stellen stehen. Die erste war die Küchentüre, den rechten Fuss im Flur und den linken Fuss jenseits der Schwelle im harschen Geruch der Küche. Die zweite Stelle war das Fenster zum Wald. Er hatte darauf zu achten begonnen, dass er nicht im gleichen Gang an beiden Stellen stehen blieb. Vom Fenster zum Wald musste er sich losreissen, am Fenster zum Wald war es gefährlich. Es war dort so einsam und belebt, das verbrauchte Grün schmeichelte das Auge so sehr. Die Bewegungen der Büsche und Bäume waren hinter den geschlossenen Fenstern unerklärlich und erschreckend. Wenn er am Fenster zum Wald stand, konnte er sich selbst für Augenblicke abschütteln. Er bekam wieder eine Ahnung dafür, was noch da war ausser seiner selbst: die Vögel, die Blätter, die Eichhörnchen, der seltene Wind. Am Fenster war ihm der eigene Tod am nächsten. Hätte er das Fenster je geöffnet, so wäre er ausgestiegen. Darum riss er sich los vom Fenster, auch wenn es schmerzte. Und er hatte das Näherkommen des Waldes bemerkt, dieses gesichtslose Heranrücken. Bald würde der Wald seinen vollen Bauch an die Scheiben drücken und sie aufsprengen. Er drehte sich mit dem Rücken zum Wald, atmete ein und atmete aus, setzte sich in Bewegung. An der Wohnungstür verlangsamte er seinen Gang. Seine Schritte streichelten den porösen Korkboden vor der Türe, seine Fussballen fühlten die nachgiebigen Unebenheiten. Er verhielt seinen Atem. Sein Gehen wurde zum Aufhorchen. Sein linkes Knie konnte unerwartet nachgeben. Seine Hände stützten sich auf den weichen lauen Boden. Doch hinter der Wohnungstüre waren keine Geräusche, kein Huschen, Husten oder Rascheln. Er wusste, dass niemand da war. Er wusste nicht, ob „ausgezogen“ das richtige Wort dafür war. Doch gab es in seiner Lage keine Möglichkeit, das Verschwinden zu beweisen. Das Verschwinden, das irgendwann eingesetzt hatte. Irgendwann in diesem schrecklichen Sommer. Es konnte sein, dass er mit seiner Schlaufe in der Wohnung die Zeit anhielt. Das konnte sein, dass er die Zeit anzuhalten begonnen hatte. Und das Verschwinden war eine mögliche Folge davon. Ein- oder zweimal am Tag nahm er seinen verbliebenen Mut zusammen, um die Wohnungstür zu öffnen. Nicht zum Lauschen, denn die Türen der Sozialwohnungen waren längst alle aus verzogenem Sperrholz. Zu oft hatte die Miliz in den Wochen vor dem schrecklichen Sommer die Türen eingeschlagen oder aufgestemmt, die Bewohner in den frühen Morgenstunden auf dem Vorplatz zusammengetrieben. Die Verwaltung war sich sehr bald zu schade gewesen, nach solchen Razzien wieder solide Wohnungstüren einzubauen. Nein, die Türen waren kein Schallschutz. Er öffnete die Türe, um zu riechen. Mit einem leichten Säuseln kamen die Gerüche zu ihm hinauf in den dritten Stock. Vielleicht stand unten die Haustüre offen, daher das leise Pfeifen im Treppenhaus. Die Luft stieg kühl und frisch aus den Kellern hinauf. Sie roch nach feuchtem Kies und nach Fussschweiss. Er stellte sich die Schuhe vor den Türen vor. Früher konnte man in den Morgenstunden oder in der Nacht darüber stolpern, wenn das Licht wieder einmal ausgefallen war. Er hatte die Schuhe immer als etwas Lebendiges erklärt, schlafende Verkörperungen. Die Luft roch nach ausgekühlten Suppen, auf denen sich ein flauschiger Schimmelteppich gebildet hatte. Die Luft trug den Duft von Tierurin zu ihm herauf, Revierspuren eines Fuchses, den er nachts schon durch die Eingangshalle und über den ersten Treppenabsatz streichen gehört hatte. Und bei offener Türe konnte er auch das singende Flattern der Tauben deutlich hören, die sich im Treppenhaus eingenistet hatten. Ihr Gurren begleitete bei geschlossener Türe seinen Gang durch die Wohnung. Der Fliesenboden des Treppenhauses war empfindlich kalt. Das war ein angenehmes Gefühl. Er war wie ein Tier, das kurz aus seinem Bau schaut. Dann schloss er die Türe wieder, setzte seinen Gang fort. In der Stube fiel ihn das Gefühl von Verlassenheit an. Der Raum war der grösste der Wohnung, der leerste. Rechts drückte sich das kleine Büchergestell mit den zwei vollen Regalen an die Wand. Auf dem Büchergestell war das Foto einer jungen Frau in einem Rahmen. Sie hatte rotes, lockiges Haar. Ihr Lachen auf der Fotografie war schüchtern. Es war ein abwartendes Lachen. Doch die junge Frau war der Kamera ganz offen zugewandt. Die Fotografie war leicht verrückt, die junge Frau lachte die Ecke an. In der Mitte der Stube lag ein verblichener runder Teppich mit konzentrischen Farbkreisen. Wie seine Socken war auch der Teppich von einem Flaum von Katzenhaar überzogen. Die Katze war zuerst weg gewesen. Jedes vierte oder fünfte Mal auf seinem Rundgang blieb er beim Fenster in der Stube stehen. Hier war es am Lautesten. Im Kasten des Rollladens wohnten die Spatzen. Weder kümmerte sie die Leere des Platzes unter ihrem Nest noch die dröhnende Stille des Mittags. Er stand reglos in der linken Ecke und lauschte auf die Geräusche der Vögel. Das Einfliegen führte zu einem Keifen und Wettern, das die Rollladen erzittern liess. Das Ausfliegen hatte einen sirrenden Ton, richtete die Härchen auf seinen Armen auf. Für Sekunden war das Rascheln nur noch das von kleinen, aufgeregten Leibern. In diesen Momenten in der linken Ecke beim Fenster konnte er plötzlich wegnicken. Sein Kopf sank auf seine nasse Brust, die Lider flatterten. Er spürte, wie seine Augäpfel in ihrer Schale verzweifelt nach dem Schlaf suchten. Sie drehten sich rastlos hin und her, spatzenhaft. Für einen oder zwei Augenblicke sank er in ein staubiges, raues Gefieder hinunter. Lange Arme zogen ihn immer tiefer in die Federwelt hinunter. Dann flog wieder ein Spatz ein, oder zwei zugleich. Er öffnete die kaum geschlossenen Augen und wandte sich dem Raum zu. Er bemerkte wieder die flaumigen Federn auf dem Rand des runden Teppichs. Es wäre ein Ausweg gewesen, sich nach ihnen zu bücken. Es war ihm nicht erklärbar, wie sie auf dem Teppich gelandet waren. Die Fenster waren seit dem Anfang geschlossen gewesen. Ein heftiges Räuspern liess ihn ganz zu sich finden. Schnell wandte er seine Augen von den konzentrischen Kreisen des Teppichs ab. Dort drin hatten sie sich schon manches Mal verloren, zwei Steine mit ihren Ringen. Wie der Schatten eines Wasserbüffels wuchs das Sofa aus der Wand, ein schwarzes Hindernis. Im Mittag stieg ein gieriger, heisser Stallgeruch von ihm auf. Sein Leder aber war geschmeidig und seidig wie das Fell eines kleinen Nagers. Sonnenstaub tanzte in den vier Streifen Licht über dem breiten Rücken. Die Sofahaut zuckte gelegentlich, wenn die Gedanken in der Tagesruhe Mut gefasst hatten und zudringlich wurden. Dann waren die mächtigen Muskeln unter dem Leder eine grosse Warnung. Darum brauchte er alle seine Aufmerksamkeit, wenn er an dem Möbel vorbeikam. Er durfte ihm nicht unterliegen. Auf den Fussballen tappte er an dem Körper vorbei. Wenn er an der Küchentür angekommen war, gelang ihm hin und wieder ein Blick zurück. Eine Art bittendes Lächeln verzog seine Züge. Er dachte vielleicht an ein aufgeschobenes Geständnis, an eine uneingestandene Ausrede. Unmöglich war es, von Gedanken zu sprechen. Unwahrscheinlich war es, an ein Leben zu denken. Es gab weder einen Ausgang noch einen Ausweg. Vorsichtig und angespannt wandte er sich dem Wald zu. Später, später würde er sich vom übermächtigen Schatten überwältigen lassen.
(Bild von Валентин Киселев auf Pixabay.)