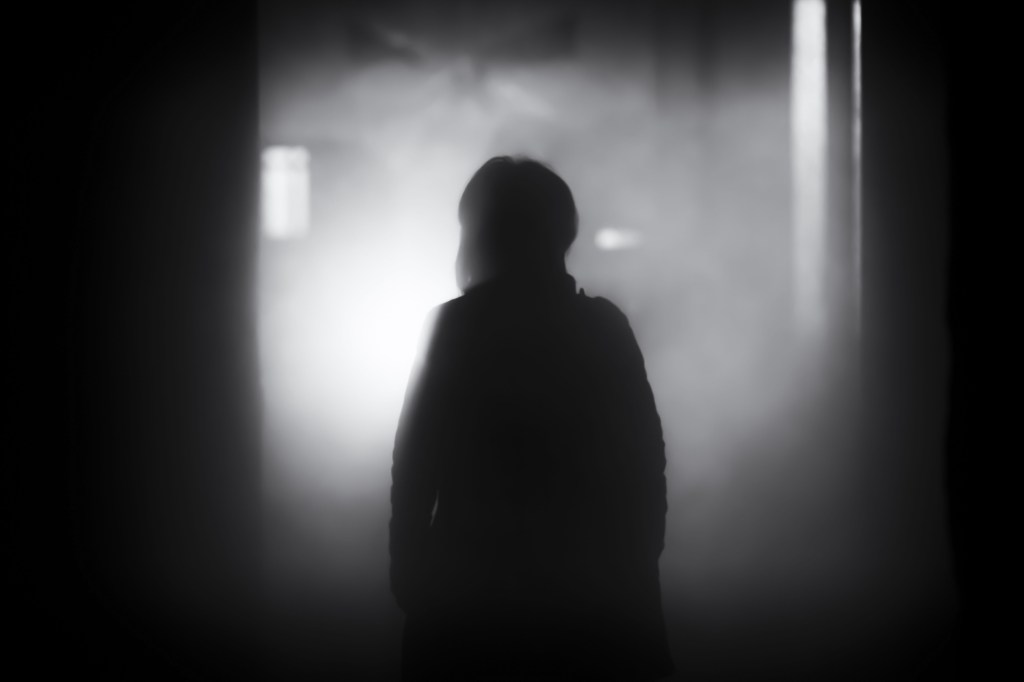Es war kein tiefer Wald, ganz gewiss nicht. Zwei, drei Eichen, einige kleinwüchsige, breit wachsende Olivenbäume, unsichere Birken und ausgreifende Haselbäume, und am Ende, zur Stadt hin, vier übermächtige Götterbäume, die fast in einem Quadrat standen. Dennoch war das Nachtigallenwäldchen im rasselnden Regen ein düsterer Ort geworden, ein entfernterer Ort. Der Mann namens Rothermund hatte ihn untergefasst und führte ihn an einen andern Ort, weg von seiner Eiche. Wieder hatte er ihr keinen Namen geschenkt, fiel Ueli ein, jedes Mal versprach er ihr das. Und jedes Mal, wenn er aus ihrem Schoss stieg, übersät mit alten Traumfetzen oder befleckt mit neuer Angströte, vergass er diesen Dank. Der Mann an seiner Seite spürte das Zögern in seinem Schritt und verstärkte seinen Druck und Zug am Arm. „Halt kommt bald,“ sagte er melodisch. Wäre ich etwa vorher gerade fast gestorben, dachte Ueli, und der hier hätte mich gerettet? Aber das war unmöglich, in der Grube der Eichenwurzel konnte niemand sterben, daraus kam nur Lebendiges. Die Eichenwurzel war ein Ort des entstehenden Bestehens, eine Vertiefung in der Welt, die in den Himmel reichte. Hiess das aber, dachte er weiter, denn im Gehen kamen die Gedanken, dieser da hatte ihn aus dem Bestehenden geholt und führte ihn fort in das blosse Entstehen? Die Füsse von Rothermund an seiner Seite tanzten voraus. Der Mann setzte die Füsse mit den Fussballen voraus auf. Darum zog er Ueli mit jedem Schrittpaar einmal nach vorne und einmal leichter nach hinten. Wieder versuchte Ueli stehen zu bleiben, um diesen Gang von hinten betrachten zu können, aber der Fremde liess ihn nicht, rückte genügend fest an ihm, um die Bewegung nach vorne aufrecht zu erhalten. Gabriela kam ihm dabei in den Sinn. Wie lange hatte er nicht mehr an sie gedacht. Gewiss war das gut gewesen, nicht an sie zu denken. Doch erinnerte er sich an den Gang das Kirchenschiff hinunter, an den leeren Bänken vorbei, Arm in Arm, vorne in der rechten Bankreihe ihr unförmiger Vater, der seinen Hut drehte und drehte, in der linken Bankreihe war seine Schwester wutrot gesessen, unterm Atem etwas wie Flüche ausstossend. Gabriela hatte an seiner Seite ausgreifende, raumfangende Schritte gemacht, mit jedem Schritt hatte sie ihn, fest eingehakt, ins Wanken gebracht. Ein Ruck vor, ein Viertel zurück. Doch Rothermund ging geschmeidiger, er zog ohne Zwang, und im Gehen musste Ueli das Nachtigallenwäldchen neu sehen. Nicht nur durch den Regen, der sanft wie Schuppen von den Augen fiel, auch durch einen seitlichen Wind hatte sich das Tal verändert. Der seitliche Wind sollte nicht möglich sein in einer kaum 50 Meter breiten Vertiefung, die der Dorenbach lautlos zerschnitt, ein Band von braun rasender Gleichgültigkeit. Die Steine in seinem Bett, über die Rothermund gehüpft war, sahen aus wie Warzen, glänzend und augenhaft, immer wieder überspült und von neuem aufleuchtend. Ein solcher Wind war nicht möglich, und doch war er sogar zu riechen, ein Geruch von süssem Aas wie aus dem Atem einer Katze. Das Nachtigallenwäldchen war ein unbekannter Ort geworden. Nicht gerade zum Fürchten, aber zum Urteilen gar nicht mehr geeignet. Ueli hielt sein Denken gerade für einen verrenkten Mann, Knochen gebrochen, Glieder puppenhaft verdreht. Doch im Gehen schaffte er doch einen Anfang, schnaufend, sammelte er die Splitter der Lupe auf, mit der die Dinge sich ins Gebiet der Wahrheit rücken liessen. Es gelang ihm, zögernd und zurückschreckend, im schwankenden Hin und Her von Rothermunds Gang in Sicherheit gewiegt, vor die Erinnerungen dieses Tages seine kleine, kaum kniehohe Mauer zu bauen, um ihre Nähe zu bannen. Und kaum hatte er damit begonnen, Urteil neben Urteil zu stellen, Zeit und Zeitläufte voneinander zu trennen, erkannte er die Stadt wieder. Sie standen auf dem Holbeinplatz: die beiden jugendlichen Linden, die beiden Bänke, die beiden Hecken, einige regenbraune zugeschlagene Felsen, die beiden Spatzenbäder, jetzt rötliche Augen. Rothermund hatte ihn losgelassen und sich auf die linke nasse Bank gesetzt. Er patschte mit seiner Hand auf den Platz neben sich. Ueli setzte sich schwer. Und schon lag die Hand Rothermunds auf seinem rechten Knie. Ueli schaute zu ihm auf. Das Gesicht des Fremden war unter einem breitkrempigen Hut verschattet, doch konnte er die runden, fast geblähten Wangen erkennen, die breiten Lippen. „Ich bin gekommen, um dir zu erzählen,“ sagte Rothermund. Sein Gesicht legte sich beim Lächeln in tausend Grübchen, eine Lache unter Wind. „Ich bin einer, der sagt,“ fuhr er fort, den Blick jetzt auf die Füsse gesenkt, „was ich sage, das vertraue ich denen an, deren Ohren sich für das Sagen eignen. Deine sind solche Ohren.“ Ueli hatte sich umgeblickt, um sich zu vergewissern. Er erkannte die kleinen Holzhäuser der Vorstadt, die Ruine eines Verwaltungsgebäudes aus Zeiten, als es noch etwas zu verwalten gab. Bevor er dem Impuls nachgeben konnte, denn er wollte aufstehen, um zu seiner Bucht zurückzukehren, hob Rothermund die Hand vom Knie auf seine Schulter, jetzt mit Kraft. „Und das Verkriechen,“ sagte Rothermund, „das kannst du noch lange genug üben, wenn alles vorbei ist… Was ich dir erzählen will, ist merkwürdig genug…“ Ueli spürte die Kälte der Bank, die Kälte des Windes. War denn wieder Winter geworden? Die Linden trugen ihre kleinen Sternenbündel… „Wie vieles beginnt das, was passiert, vor langer Zeit. Ein Bündel von Informationen, verstreut über verschiedene Körper. Der Mechanismus lässt sich erkennen, wenn auch nicht sein Urheber. Und doch ist dieser nicht von der Hand zu weisen… Vielleicht ist doch eher von einer Urheberin zu reden, wer weiss… Merkst du, wie schwer es mir fällt, das erste Mal zu sagen?“ Ueli blickte Rothermund an, doch dieser schaute zu Boden. „Es sind Vorbereitungen zu treffen, bevor man vorbereitet ist. Ich habe, merke ich, keine getroffen. Vielleicht soll es so sein, vielleicht. Das Sagen ist keine Wissenschaft, so denke ich wenigstens, aber das Sagen ist von Bedeutung.“ Wieder schwieg Rothermund, nahm die Hand von Uelis Schulter und strich damit über seine breiten Lippen, liess den Zeigefinger darauf ruhen. „Einen Auftrag zu haben, ist das eine. Den Auftrag dem Auftrag gerecht auszuführen, das andere… Und den Auftrag mit Gleichmut ausführen, wieder etwas anderes… Niemand kann dem Erzählten zuvorkommen. Niemand kann das Geschehene anders empfangen als wehrlos. Niemand kann das Sagen anders sagen als erstmals, so lange dieses Sagen auch schon warten oder dauern mag. Nun, so höre hin.“ Rothermund schüttelte sich in den Schultern und richtete sich auf. „Alles war gut. Das Fruchtwasser bedeckte die Erde. Im Fruchtwasser tummelte sich an der Grenze zur Sichtbarkeit das Leben. Ein schlürfendes Wiegen in Gewissheit, zukunftslos. Ein keimendes Gespinst, Daseins-Gewebe. Ungeformt-haltlos, darin aber beharrlich, fast unabänderlich. Doch immerhin, erste Strömungsabfälle, kleinste Zyklen, fast eigensinnige Gegenläufe. Im vom meeraufwerfenden Mondzyklus um- und umgedrehten Meer entstehen Blasen. Zuerst kaum grösser als die Zitzen eines Maulwurfs, doch Blasen blähen sich, das ist ihr einziges Tun. Sie schwellen an, verschlingen vom Gespinst, was verschlungen gehört. So würden es die Blasen sehen. Lange Zeit sind die Blasen eine Art Augen, die im Ungesehenen aufgegangen sind. Und in ihnen geschieht das Ungeschehene, mehr als Mehrung. Was Äonen gelebt und gewebt hat, in einem losen Schlingen und Umschlingen, in einem leicht zuckerhaltigen Taumel, wächst an, bläht sich wie die Blasen, und während die Blasen wie Tränen miteinander verwachsen, verwächst dieses Kringeln und Flimmern. Während der Mond mit seinem silbernen Arm die Erde wiegt, beginnt die Zeit. Sie beginnt mit dem Versteifen, die Zeit. Anders ist es nicht zu sagen, das Zusammenwachsen des ersten Taumels ist das Ausstrecken eines ersten Fingers, dann einer ersten Hand. Eine strebende, noch nicht zeigende Bewegung der Versteifung im Flirren und Kirren, gleich neben den Blasen. Ein stechendes Längen und Drängen stellt die Spannkraft der Blasen in Frage. Die Blasen reissen. Was aus ihnen quillt, dieser heiss-innere Saft, das Unabänderlich-Beharrliche, schmiegt sich an die beharrlichen Säulen, die da stechen und fechten. Ist die Zeit nicht Fechten und Stechen, ein wegloses Abkommen mit der Auflösung?“ Rothermund schwieg unerwartet nach seiner unerwarteten Frage. Er selbst fühlte sich plötzlich schwer, hörte ein Knarren in der Bank, auf der sie sassen. Die beiden Linden streckten ihre Äste nach allen Seiten nach den Vögeln aus, den verlorenen Stimmen. Sie waren mehr denn je ohne Halt, die feuchte Mauer des Himmels zu weit, zu hart für ihr ausgestrecktes, haarsträubendes Bitten, für ihr niederes, windloses Kratzen. Ueli dachte an einen Spruch, „Wessen Weisheit grösser ist als seine Werke, wem der wohl gleicht? Einem Baum, der viele Äste hat und wenig Wurzeln. Es kommt der Sturm, er reisst ihn aus und wirft ihn um.“ Ueli hatte nicht gedacht, dass ihm je wieder so eine Geschichte begegnen würde, und am wenigsten in dieser Lage. Ueli hatte nicht gedacht, dass es noch solche Geschichten gab, und am wenigsten für diese Lage. Ueli hatte nicht gedacht, wie gerne er miterzählen würde, und am wenigsten aus seiner Lage. Er sehnte sich nach Papier, nach Karton, er wollte einen Stift. Wie lange hatte er keinen Stift mehr gehalten, weder Kohle noch Kreide noch Tusche. Seine Hände zuckten. Die Bank knarrte wieder, Ueli konnte die Freude wie Schweissperlen über Rothermunds Gesicht laufen sehen. „Und was weich und fliessend gewesen war, verschmolz mit dem ersten belebten Harten. Was weich gelebt hatte, begann sich zu verhärten. Und was in der Weichheit geschlummert hatte, wachte in der Härte auf. Metallisch glänzten die Wirbelsäulen auf, die Schuppen, die Flossen, die Finger darin, die Beine und Arme. Was vorher an Dingen klebte, webte, an Felsen, Schloten, Steinesblüten, kaum weste, fast dingte, unbeirrbar zwecklos, unhaftbar anhaftend, begann zu zwicken, zwecken. Denn in den Dingen liegt kein Streben. Ein Streben liegt in den Lebewesen. Doch keines der Lebewesen konnte über sich hinaus. Das Wesende in ihnen, das den Dingen anhaftete, teilte sich unaufhaltsam. Erfasst von der Zeit, teilte und wandelte es sich, dingte sich zum Wesen. Nach oben war alles offen, das Land zuerst, der Himmel danach. Ein Wälzen nach Zielen, ein Drehen um Zwecke. Geschah das Teilen aus sich selbst heraus, damit etwas würde? Geschah das Wandeln aus sich selbst heraus, damit etwas geschehe? Eine Lenkerin ist schwer vorstellbar. Die gestaltende Hand bleibt unsichtbar. Eine Vielzahl von Gestalten wurde wahrscheinlich, möglich, wirklich. Aus dem Gestade des Wirklichen stiegen die Lebewesen herauf. So könnte man erzählen, stiegen herauf, stiegen herauf, stiegen herauf.“ Plötzlich brach Rothermund in Singen aus: „Da west es an Steinen, hier blüht’s in den Rainen, da heckt es die Seinen, da zappelt’s mit Beinen. So will es hinauf, so will es den Lauf, so will es der Lauf, so will es der Hauf. Denn viele sind Werden, und viele sind Scherben, von denen wir erben, voran sie uns herden.“ Das Schweigen war nicht angenehm. Ueli versuchte sich an das erzählte Nichts zu klammern, doch gab das Klammern nichts her. Lauter Schlingpflanzen, die im Regen wuchsen, sie schnitten in die Hände, und die Hände rutschten daran ab. Sein ganzer Körper, Kleider und Haare, waren nass. In seinem Nacken rieselte das Wasser von den Haaren den Rücken hinunter. Sein Atem füllte die trockenen Innenräume seines Körpers, hinterliess leichte Kondensspuren zurück auf dem Herz, der Leber. Auf dem Holbeinplatz war es immer angenehm zu sitzen. Doch, wie er begriff, nicht in diesem Schweigen. Es war ein Schweigen, das zu viel zu sagen hatte, das noch zu viel zu sagen hatte. Rothermund an seiner Seite hatte seinen Mund nicht geschlossen, und über dem Mund die Augen waren hell erleuchtet und fixierten etwas Monströses. Ueli dachte daran, was seine Mutter am Ende von Geschichten gesagt hatte. Er hatte es als Kind immer für eine Art Gegenspruch gehalten. Später als Erwachsener glaubte er zu verstehen, dass sie den Spruch mehr als Erinnerung an die Beharrlichkeit der Wirklichkeit gebraucht hatte, um die Veränderungskraft einer Geschichte zu mindern. „Und die Frösche blieben Frösche, die Monster Monster,“ sagte Ueli in die Stille, denn der Spruch musste jetzt heraus. Rothermund dreht ihm sein scharfes Gesicht zu, in den Augen ein glasiges Erschrecken, der Mund hechelt. Dann zerbricht er die zurückgekehrte Stille mit einem glasklaren Lachen. „Ja, ja,“ sagte Rothermund, seine Stimme in ein feuchtes Kichern herunterwürgend, „so ist es immer. Die meisten wissen bereits darum. Ich musste noch nie die ganze Geschichte erzählen. Das tröstet mich immer wieder. Und jeder einzelne hat noch dieses natürliche Widerstreben dagegen. Es ist einfach herrlich.“ Er fuhr sich mit den flachen Händen über das durchlachte Gesicht, das müde und erwartungsvoll aussah. „Du hast nichts erzählt,“ sagte Ueli, „das kann ich beurteilen. Menschen haben mir jeden Tag Geschichten erzählt, sogar die Schweigenden. Ich erkenne inzwischen jede Geschichte daran, ob sie das Gleiche sagt wie die andern. Diese Geschichte sagt nicht das Gleiche, diese Geschichte sagt nichts.“ Rothermund neigte sich zu ihm hinüber, berührte ihn am Ellbogen. „Es ist ja auch keine Geschichte, Ulrich,“ sagte er, „es ist ja auch keine Geschichte. Denn sie kommt von der Quelle. Sie hat es mir selbst erzählt. Immer wieder hat sie es mir erzählt. So höre denn zu, denn das war ja nur der Anfang.“ Der Regen über dem Platz hatte wieder eingesetzt, ein graues Gleissen lag über den Linden, die sich in Winderinnerungen wiegten.